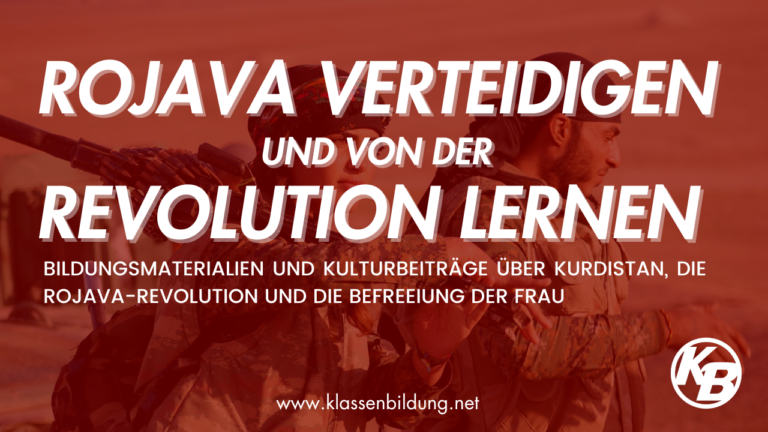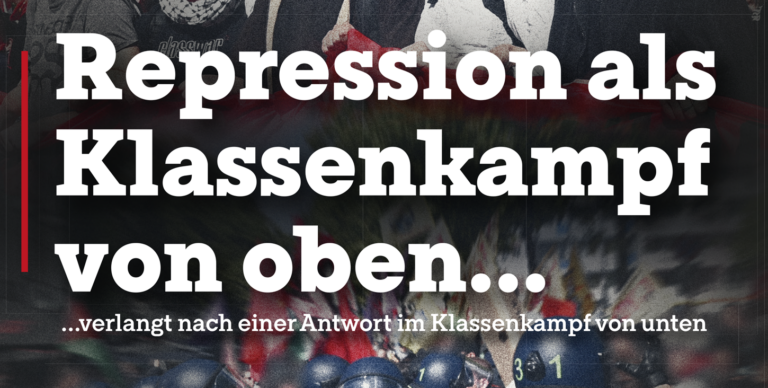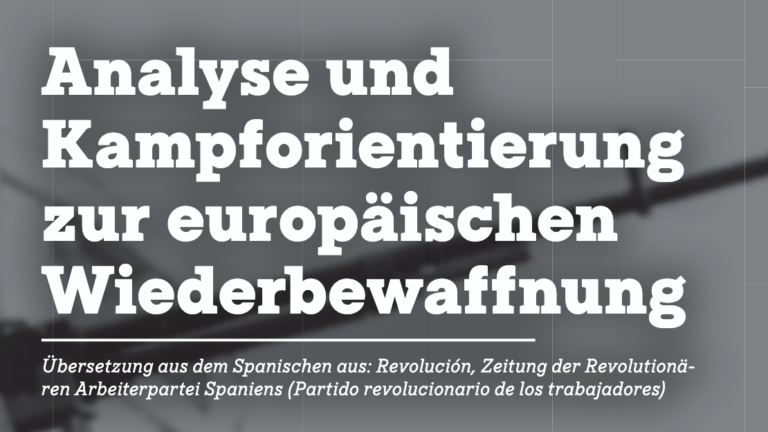Wir wollen im folgenden eine Reihe von praktisch-methodischen Fragen im Zusammenhang mit der theoretischen Arbeit erläutern. Dieser Text soll einerseits dazu dienen, Genoss:innen an die eigenständige theoretische Arbeit heranzuführen, die bisher noch nicht damit zu tun hatten, um ihnen damit sozusagen eine „Starthilfe“ zu geben. Darüber hinaus werden aber auch einige methodische Fragen diskutiert, die auch für erfahrenere Genoss:innen hilfreich sein können, um ihren Arbeitsstil weiterzuentwickeln.
Zunächst müssen wir feststellen, dass die theoretischen Themen und Fragestellungen, die bei uns aufkommen, sehr vielfältig sind. Oftmals entstehen theoretische Fragen unmittelbar aus Bedürfnissen in der praktischen Arbeit. Sie können aber auch aus grundsätzlichen Diskussionen heraus auftreten. Ebenso können sie mehr oder weniger spezifisch sowie mehr oder weniger umfangreich sein. Dazu einige Beispiele:
- Es ist erforderlich, eine Einschätzung der politischen Strömung XY zu erarbeiten, weil wir mit ihr praktisch in Berührung gekommen sind.
- In Diskussionen kommt die Frage auf, wie eine historische Entwicklung einzuschätzen ist (wie etwa die revisionistische Entartung und der spätere Zerfall der Sowjetunion).
- Wir sind auf die Notwendigkeit gestoßen, grundlegend eine materialistische Position zu einem Themenkomplex herauszuarbeiten oder weiterzuentwickeln (z. B. Psychologie, Geschlecht, o. ä.).
- Aktuelle politische Erscheinungen und Entwicklungen sollen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus analysiert werden (z. B. Bäuer:innen in Deutschland, die Klassenstruktur und kommunistische Arbeit in der Provinz, o. ä.).
Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass sich die konkrete kommunistische Politik nach der Ideologie, der Analyse der konkreten Weltlage und der daraus abgeleiteten Strategie und Taktik richten muss, was alles im weiteren Sinne in den Bereich der „theoretischen Arbeit“ fällt. Das bedeutet, die Theoriearbeit muss weitsichtig angelegt sein und überhaupt die Fragestellungen identifizieren, die in Zukunft politisch wichtig sein werden. Das können ganz andere sein als diejenigen, die gerade alle im Kopf haben.
Ein gutes Beispiel hierzu aus der jüngeren Geschichte: Als im Jahr 2019 alle Welt nur über Klima und Umwelt geredet hat, haben sich einige politische Kräfte zugleich vorausschauend mit der Frage der bevorstehenden Wirtschaftskrise und sich verschärfender imperialistischer Auseinandersetzungen beschäftigt. Hieraus resultierte die Feststellung, dass die Weltlage innerhalb weniger Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit qualitativ „anders“ aussehen würde als zum damaligen Zeitpunkt. Diese Einschätzung hat sich im späteren Verlauf mit dem erneuten Kriseneinbruch, der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs als richtig herausgestellt. Genau das und noch mehr muss die theoretisch-ideologische Arbeit leisten. Einem spontaneistischen, rein an praktischen Tagesbedürfnissen orientierten Herangehen hätte es dagegen entsprochen, alle (auch theoretischen) Kräfte auf die Klima- und Umweltfrage zu fokussieren.
Das heißt: Theoretische Arbeit darf nicht als eine Art Serviceleistung verstanden werden, um in der praktischen Arbeit und Diskussionen auf der Straße ein besseres Bild abzugeben, sondern muss allseitig die Grundlagen für die zukünftige Ausrichtung der politischen Arbeit schaffen. Was nicht heißt, dass in einem Theorieorgan nicht auch konkrete Fragen, die in der politischen Praxis auftreten, beantwortet werden sollen.
Mit diesem grundsätzlichen Verständnis im Kopf können wir an die Arbeit gehen. Daraus ergibt sich, dass mit Beginn der theoretischen Arbeit ein kollektiver Arbeitsprozess sinnvoll ist.
Nehmen wir an, wir haben ein konkretes Thema, zu dem gearbeitet werden soll, und es soll nach Möglichkeit in absehbarer Zeit ein mehr oder weniger umfangreicher Text dazu entstehen. Welche sind jetzt die grundlegenden Schritte in der Arbeit?
1. Klärung der konkreten Fragestellung:
Wir müssen zunächst einmal klar haben, was eigentlich die Frage ist und was wir mit einer Ausarbeitung zu dieser Frage überhaupt erreichen wollen. Konkret heißt das, die folgenden Fragen zu beantworten (wobei es sich empfiehlt, diese Ausrichtung schriftlich festzuhalten, um die Ergebnisse aus späteren Arbeitsschritten danach zu beurteilen):
1. Welches Ziel verfolgen wir gegenüber dem Thema XY? Geht es zum Beispiel darum, einen kurzen Artikel zu einer konkreten Frage zu schreiben oder darum, eine längere, grundsätzliche und möglichst allseitige Ausarbeitung anzufertigen? Welches politische Bedürfnis soll ein Text am Ende befriedigen?
2. Auf welchen Grundlagen können wir bei der Arbeit bereits aufbauen? Gab es in der Vergangenheit schon eigene Veröffentlichungen hierzu, die vor allem vertieft werden müssen, oder müssen wir eine Frage grundsätzlich neu erforschen?
3. Wo liegen konkret unsere Wissens- und Verständnislücken, also welche sind letztlich die zu klärenden Fragen? Kennen wir überhaupt alle unsere Wissenslücken und relevanten Fragen schon, das heißt: Haben wir nur bekannte Unklarheiten zu klären? Oder gibt es auch „unbekannte Unklarheiten“? Dazu zwei Beispiele: Bei einem Artikel über das Nichtangriffsabkommen der Sowjetunion mit Hitlerdeutschland im Jahr 1939 weiß ich bei Beginn der Arbeit schon, dass ich mir die genauen Inhalte des Abkommens noch angucken muss, weil ich sie nicht kenne. Das ist eine bekannte Unklarheit bzw. Wissenslücke. Von einer bisher unbekannten Wissenslücke oder unbekannten Unklarheit würde man dann sprechen, wenn ich während der Recherche darauf stoße, dass neben dem Nichtangriffsabkommen noch eine Reihe von Wirtschaftsverträgen zwischen beiden Ländern geschlossen worden sind, von denen ich noch nie gehört hatte, und die mich dazu veranlassen, den Umfang meiner ursprünglich geplanten Recherche zu erweitern: Eben weil eine politische Einschätzung die Gesamtheit der Verträge berücksichtigen muss und nicht einen Teil davon ausklammern kann.
Mit unbekannten Unklarheiten muss ich immer rechnen, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, das für mich weitgehend neu ist oder in das ich noch nie wirklich tief eingestiegen bin. Hauptsächlich bekannte Wissenslücken – oder anders gesagt: Einen guten Überblick über ein Thema – habe ich dann, wenn ich mich damit schon einige Zeit beschäftigt habe. Das bedeutet übrigens auch: Expert:in auf einem Themengebiet zu sein, bedeutet nicht, gar keine Wissenslücken mehr zu haben. Das kommt nämlich höchst selten nur vor. Sondern eben, einen Überblick zu haben.
4. Wie umfangreich soll der Text sein, der am Ende entsteht? Anders als in Frage 1 geht es hier darum, auf Grundlage der obigen Frage ein konkretes Arbeitsziel und Pensum z. B. in Seitenzahlen festzulegen.
Es macht wie bereits oben gesagt sehr viel Sinn, diese Fragen im Vorfeld einmal systematisch zu beantworten und die Ergebnisse schriftlich festzuhalten, um sich dann im weiteren Prozess diese Ausrichtung in der Arbeit immer wieder selbst vor Augen führen zu können.
2. Quellen bestimmen und lesen
Theoriearbeit ist wissenschaftliche Arbeit und basiert als absolut unerlässlichem Fundament darauf, dass man sich mit den Erscheinungen der Welt gründlich, konkret und sorgfältig befasst. Dazu gehört im Falle von politischer Theorie insbesondere das möglichst professionelle Arbeiten mit Quellen. Auch wenn wir uns in aller Regel nicht wie Karl Marx bei der Ausarbeitung des „Kapital“ mehrere Jahrzehnte Zeit nehmen können, um die Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus von allen Seiten zu studieren und wir an einem bestimmten Punkt eben pragmatisch sein müssen, müssen wir der Quellenarbeit dennoch ausreichend Zeit einräumen.
Dabei sind folgende Arbeitsschritte und methodische Herangehensweisen erforderlich:
1. Suche und Sortierung von Quellen
a) Wir müssen als erstes systematisch sammeln, welche Quellen überhaupt herangezogen werden sollen (z. B. Klassikertexte, Sekundärliteratur, sonstige Fachliteratur etc.). Die Suche nach geeigneten Quellen muss dabei grundsätzlich immer nach zwei Seiten erfolgen, nämlich einerseits nach marxistischen und andererseits nach bürgerlichen Quellen. Bei guten marxistischen Quellen und insbesondere Klassikertexten können wir im ersten Schritt davon ausgehen, dass wir uns inhaltlich und methodisch stark auf sie stützen können (was aber keinesfalls ausschließt, dass wir dort auch Fehler finden oder es inzwischen neue Erscheinungen gibt, die beim Verfassen der Quelle noch nicht bekannt waren). Bei bürgerlichen Quellen müssen wir dagegen immer darauf achten, richtige Inhalte von falschen zu trennen und nicht auf methodische Fehler, einseitige Interpretationen und unvollständig dargestellte Fakten hereinzufallen.
b) Wir müssen uns einen genaueren Überblick über die Quellenlage verschaffen: Gibt es Standardwerke zum Thema (wie z. B. „Das Kapital“ zur politischen Ökonomie)? Was ist die relevante Kernliteratur, was ist nützliche Literatur für weiterführende Detailfragen?
c) Ganz wichtig bei der Quellenauswahl ist es, sich auch einen Überblick darüber zu verschaffen, welche die wichtigsten bürgerlichen und antimarxistischen Theorien zu unserer Fragestellung sind. Das schließt z. B. bürgerliche Kritiken an der kommunistischen Bewegung, Methodik und Ideologie mit ein.
d) Wir müssen die Quellen anhand ihrer Qualität unterscheiden. Wikipedia z. B. ist grundsätzlich keine wissenschaftliche Quelle, die man zitieren kann. Das bedeutet nicht, dass man bei der Recherche nicht auch Wikipedia-Artikel lesen kann, z. B. um einen ersten Überblick über Fakten zu einem Thema zu bekommen und gegebenenfalls neue Quellen dort zu finden. Zitieren können wir aber immer nur wissenschaftliche Quellen sowie Originaldokumente, gegebenenfalls Zeitungsartikel usw.
e) Bei jeder Quelle – unabhängig davon, ob es um bürgerliche oder sozialistische Literatur geht – müssen wir kritisch hinterfragen, mit welcher Intention ein Artikel, Text o. ä. geschrieben wurde, in welchem historischen Kontext er entstanden ist, wo seine Lücken liegen etc.
2. Arbeit mit den Quellen
a) Nach der Bestimmung und Sortierung der Quellen sollen diese möglichst systematisch gelesen werden: Dabei ist es ratsam, mit Standardwerken zu beginnen und sich danach zu weiterführender Literatur durchzuarbeiten. Bei der Quellenlektüre ist es dringend empfohlen, Notizen oder besser noch Konspekte anzufertigen (zur Anfertigung von Konspekten siehe z. B. den Text „Wie arbeitet man mit dem Buch?“1).
b) Notizen können je nach Arbeitsstil in unterschiedlichem Umfang angelegt werden. Ein Vorteil davon, wichtige Erkenntnisse oder Zitate „herauszuschreiben“ ist es, dass wir sie später leichter „wiederfinden“ können und dies dabei helfen kann, eine Grundstruktur eines Textes entstehen zu lassen, während wir unsere Notizen sortieren.
c) Wir sollten bei dieser Forschungsarbeit immer möglichst neugierig und hartnäckig bleiben und uns von keiner noch so guten Quelle und ihrer vermeintlichen Autorität „einlullen“ lassen: Stattdessen ist es hilfreich, immer wieder kritisch möglichst einfache Fragen zu formulieren und bei sich selbst nachzubohren: Warum ist etwas so und so? Warum wird im „Kapital“ als erstes die Ware als grundlegendes Element untersucht? Wie ist Erscheinung XY historisch entstanden? usw. usf. Umfassende Neugierde und ständiges kritisches Hinterfragen schützt uns vor Bequemlichkeit bei der theoretischen Arbeit, und das hilft wiederum bei der Vermeidung von Fehlern.
Mit den geschilderten Arbeitsschritten und Methoden kommen wir im Rahmen der Quellenlektüre zu Notizen, Erkenntnissen, Fragen, stellen neue Fragen, sortieren Erscheinungen und Argumentationsketten in unserem Kopf usw. Um sich dabei immer wieder zu sammeln, den eigenen Überblick über ein Thema zu verbessern, den eigenen Erkenntnisstand kritisch zu überprüfen und sich nicht in Nebensächlichkeiten oder Spezialfragen zu verrennen, macht es sehr viel Sinn, regelmäßig auch mit anderen über auftretende Fragen und den Stand der Arbeit zu diskutieren.
3. Arbeitshypothesen herausarbeiten
Das Quellenstudium sollte uns in Verbindung mit eigenem Nachdenken, Diskussionen, Fragen stellen usw. in die Lage versetzen, erste Arbeitshypothesen zu formulieren und möglichst in einem gegliederten Thesenpapier festzuhalten. Dies ist kein starrer Prozess vom Schritt „Lesen“ nach Schritt „Thesen schreiben“, sondern erfolgt in der Regel mehrstufig: Selbstverständlich können beim Formulieren von Thesen neue Fragen auftreten, die dann wieder untersucht werden müssen.
Dabei muss geschaut werden, welche Fragen jetzt und welche erst in Zukunft sorgfältig geklärt werden können (je nach Thema und Vorkenntnissen kann die Forschung zu einem Gebiet durchaus Jahre in Anspruch nehmen). Es ist legitim, auch vorläufige Arbeitshypothesen in einem Artikel zu veröffentlichen, wenn man das offen so schreibt.
Dialektische Methode angewandt?
Spätestens bei der Erstellung von Arbeitshypothesen sollten wir auch kritisch unsere Methode überprüfen, das heißt reflektieren, ob wir der Fragestellung wirklich dialektisch auf den Grund gegangen sind. Das bedeutet konkret, sich die folgenden Fragen zu stellen:
- Haben wir die infrage stehende Erscheinung wirklich in ihrer Entwicklung betrachtet, sind wir zu den elementarsten Grundlagen zurückgegangen oder haben wir noch einen relativ unübersichtlichen „Wust“ von Erscheinungen vor uns? (Beispiel: Marx fängt im „Kapital“ nicht mit der Vielfalt von Erscheinungen im Kapitalismus wie Lohnarbeit, Industrie, Maschinen, Zinsen, Aktien usw. an, sondern macht die Ware als elementarste Erscheinung aus, die als erstes zu untersuchen ist. Danach geht er von dieser einfachen Erscheinung zu den komplizierteren Erscheinungen.)
- Gehen wir danach schrittweise zu den Wechselwirkungen mit anderen Elementen sowie den komplizierteren Erscheinungen über oder haben wir noch Lücken in unserer Argumentation?
- Haben wir verstanden, wo es auf dem betrachteten Gebiet infolge der Wechselwirkung verschiedener elementarer Erscheinungen miteinander zu qualitativen Sprüngen kommt? (Beim Thema „Geschlecht“ wäre dies z. B. der Übergang vom Tier zum Menschen und damit das Aufkommen und in den Vordergrund treten der gesellschaftlichen Geschlechtsfunktion.)
- Haben wir die inneren Widersprüche in den Erscheinungen herausgearbeitet und verstanden?
Wichtigste Theorien und Thesen zu einem Thema verstanden?
Ein wesentlicher Punkt schon bei der Quellenauswahl ist die Bestimmung der wichtigsten bürgerlichen und antimarxistischen Theorien zu einer Fragestellung. Das schließt nicht nur „Theorien“ im engeren Sinne ein (wie z. B. Postmodernismus, Feminismus, Liberalismus o. ä.), sondern auch, was bürgerliche Autor:innen zu einer Fragestellung in der Vergangenheit gesagt haben oder heute vertreten. Hierbei ist es jeweils wichtig, die bürgerlichen Theorien möglichst gut zu durchdringen, den wahren Kern innerhalb dieser dialektisch herauszuarbeiten und zugleich herauszuarbeiten, wo diese Theorien falsch, d. h. idealistisch, mechanisch oder ähnliches sind. Konkret bedeutet das:
- Wir müssen immer in der Lage sein, die wichtigsten und gängigsten falschen Auffassungen zu einem Fragekomplex möglichst präzise zusammenzufassen, um sie auf dieser Grundlage kritisieren zu können. Dies ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Erstellung von Notizen bei der Quellenlektüre sowie gegebenenfalls später bei der Erstellung von Gliederungen und Thesenpapieren.
- Dieselbe Methode wenden wir auf marxistische Quellen an, die z. B. überholt sind oder vertieft werden müssen (oder auch nicht). Auch hier ist die Grundlage von allem weiteren, dass wir präzise die Kernaussagen dieser Quellen verstanden haben und in der Lage sind, sie korrekt wiederzugeben.
- Beides kann man testen, indem man einer anderen Person zu erklären versucht, was man gerade gelesen hat.
Typische methodische Fehler vermieden?
Im Rahmen dieses Arbeitsschrittes überprüfen wir uns selbst auch nochmal kritisch auf gängige Fehler in der Methode. Dazu gehören unter anderem folgende Schritte:
- Fakten überprüfen: Hier gilt es, Fakten und Tatsachenbehauptungen alle nochmal gegen zu checken. Sind falsche Zahlen, Zitate usw. aufgeschrieben worden, die ich ungenau im Kopf hatte? Habe ich die Statistiken wirklich richtig gelesen?
- Überprüfen, ob meine Thesen wissenschaftlich hergeleitet wurden: Habe ich unbewusst nur die Quellen, Tatsachen, Statistiken, u. ä. mit in meine Notizen übernommen, die meine Arbeitshypothesen stützen? Gibt es Fakten und Quellen, die meinen Thesen widersprechen? Habe ich bewusst danach gesucht und darüber nachgedacht?
- Überprüfen, ob eine subjektive Färbung eingeflossen ist: Habe ich Positionen oder Tatsachen ignoriert, die mir subjektiv missfallen? Versuche ich Positionen, die mir sehr missfallen, leichtfertig als Blödsinn abzutun, ohne konkret zu argumentieren? Bin ich bei der Erarbeitung meiner Thesen wirklich objektiv vorgegangen oder habe ich mich z. B. von der Diskussion in meinem Umfeld, der allgemeinen Nachrichtenlage oder anderen Faktoren beeinflussen lassen? Habe ich bei der Erarbeitung meiner Thesen alle mir zur Verfügung stehenden Quellen gleich berücksichtigt oder ist z. B. die Quelle, die ich zuletzt gelesen habe, oder die in meinem Umfeld sehr gelobt wurde, überproportional in meine Thesen eingegangen?
- Überprüfen, ob kurzfristige Einflüsse überbetont sind: Habe ich eine Erscheinung, die gerade sehr viel diskutiert wird, in meiner Argumentation stark überbewertet? Habe ich Entwicklungen, die seit einiger Zeit stattfinden, unkritisch in die Zukunft übertragen?
Auf der Grundlage der oben aufgeführten Fragen soll das Thesenpapier/die Gliederung in mehreren Stufen kritisch überprüft und diskutiert werden. Danach dient es als Grundlage für die Erarbeitung des Artikels.
4. Artikel schreiben
Wir können uns jetzt daranmachen, den Text für unseren Artikel aufzuschreiben. Bevor wir das tun, sollten wir nochmal (wie unter 1. beschrieben) nachlesen, was wir zu Ziel und Zielgruppe des Textes festgehalten hatten und welches Bedürfnis er befriedigen soll. Ausgehend von diesen Fragen bestimmen wir dann, wie eine geeignete Darstellung der erarbeiteten Inhalte aussehen kann (z. B. welche Fragen sollen vertieft werden, welche gegnerischen Positionen sollen wie ausführlich dargestellt werden usw.)
Wenn die Schritte 1 bis 3 von oben befolgt wurden und eine Klarheit zum gegebenen Thema erarbeitet wurde, sollte es auch möglich sein, die Inhalte in möglichst einfacher und präziser Form nieder zu schreiben.
Trotzdem tun sich viele, auch erfahrene Autor:innen gerade mit dem Niederschreiben von Texten manchmal besonders schwer. Es handelt sich schließlich um einen kreativen Prozess, der je nach Individuum und Arbeitsstil sehr unterschiedlich vonstatten gehen kann. Die Angst von Autor:innen vor einem leeren Blatt Papier (bzw. Textdokument) ist ein bekanntes Phänomen auch in der Weltliteratur und hat zu allerlei Intellektuellen-Mythen und vermeintlich guten Ratschlägen geführt. Diese sollten wir alle vergessen. Denn die Lösung des Schreibproblems liegt am Ende nicht in individuellen Marotten, einer vermeintlichen Genialität der Autor:in (wie es Intellektuelle häufig von sich glauben) oder dem Glauben, dass wir „den Druck eben bräuchten“, sondern in Planmäßigkeit und Organisiertheit:
- Wir legen Deadlines für die Erstellung von Textentwürfen fest und halten uns ausreichende Zeiträume frei, in denen wir konzentriert am Text arbeiten.
- Die Zeiträume legen wir nicht ganz kurz vor die Deadline, sondern lassen uns nach hinten ausreichend Zeitpuffer. Wir schätzen vorher ab, wie viel Zeit wir in etwa für welchen Teil des Textes benötigen.
- Wir legen uns die Zeiträume so, dass wir möglichst ein kontinuierliches Arbeiten sicherstellen können. Wenn wir z. B. einen Text aus vier ähnlich komplexen Abschnitten in vier Wochen schreiben wollen, ist es häufig sinnvoll, sich für jeden der Abschnitte jeweils eine Woche Zeit einzuräumen.
- Wir identifizieren die Zeiträume, in denen wir gut kreativ arbeiten können und die, bei denen das weniger der Fall ist. Manche Leute können z. B. morgens von 9-12 Uhr sehr produktiv sein und sind es am frühen Nachmittag weniger. Das muss jede:r für sich herausfinden. Die Schreibphasen sollte man in die produktiven Zeiträume legen, während man Überarbeitungsschritte und sonstige Arbeiten eher in die „unproduktiven“ Zeiträume legen kann.
- Wir erhöhen unsere Arbeitsqualität und -produktivität ungemein, wenn wir Ablenkungen vermeiden. Es empfiehlt sich also, in Schreibphasen auf Nachrichten checken zu verzichten, das Handy auszumachen oder wegzulegen und gegebenenfalls eine Bibliothek aufzusuchen, wenn ansonsten Mitbewohner:innen oder das Telefon den Arbeitsprozess stören würden. Es macht Sinn, sich auf diese Weise immer wieder Zeiträume von mehreren Stunden ungestörten Arbeitens am Stück zu schaffen.
- Man erleichtert sich die Arbeit häufig, wenn man mit den Textteilen anfängt, die man am einfachsten runterschreiben kann oder die man am spannendsten findet. Auch sollte man sich fragen, ob es Teile oder Punkte gibt, von denen man weiß, dass sie einem schwerfallen werden (z. B. ein theoretischer Aspekt der politischen Ökonomie, den man vielleicht noch nicht ausreichend verstanden hat und der eine Rolle spielt? Wenn ja, welche Hilfe kann man sich holen?).
- Einleitungen und Schlusskapitel schreibt man idealerweise am Ende, wenn der Rest des Textes fertig ist und konkrete Aussagen und Schlossfolgerungen sich in den noch ausstehenden Bearbeitungsschritten nicht mehr wesentlich ändern.
5. Kollektive Diskussion und Überarbeitung
Nachdem der erste Entwurf des Textes erfolgt verfasst wurde, sollte dieser mit dem politischen Kollektiv gemeinsam diskutiert und kritisiert werden. Je kollektiver bereits die Zwischenstände der zuvor genannten Schritte immer wieder kontrolliert oder diskutiert wurden, desto produktiver sollte dann auch die kollektive Diskussion sein und keine bösen Überraschungen – wie sehr unterschiedliche Erwartungen an den Text – mit sich bringen.
Nach der kollektiven Diskussion heißt es dann meist, sich noch einmal an den Text heran zu setzen, die Kritiken aus der Diskussion einzuarbeiten und dem Text seinen letzten sprachlichen Schliff zu geben. Dafür kann es wenn möglich auch Sinn ergeben, eine andere Person anzufragen, um bei der sprachlichen Endüberarbeitung und Fehlerkorrektur zu helfen, da man selbst den Text vermutlich schon zu oft gelesen hat, um noch Fehler oder zu umständlich formulierte Sätze zu finden, die korrigiert werden sollten.
Danach steht einer Veröffentlichung und Verbreitung des Textes nichts mehr im Wege!
Die oben genannten Stichpunkte, Fragen und Listen mit Tipps ließen sich sicherlich noch weiter ergänzen. Die Befolgung der beschriebenen Arbeitsschritte und Methoden sollte den Einstieg in die eigenständige theoretische Arbeit jedoch bereits vereinfachen und dazu dienen, eine deutliche Erhöhung der Qualität dieser Arbeit zu bewirken.
1 Primakowski, A. (1954): „Wie arbeitet man mit dem Buch?“ https://www.verlag-benario-baum.de/WebRoot/HostEurope/Shops/es151175/MediaGallery/PDF-Dateien/Studieren_-_Propagieren_-_Organisieren.pdf