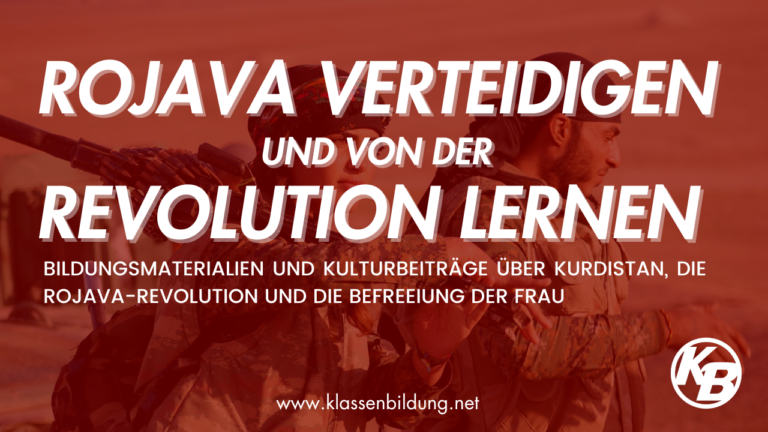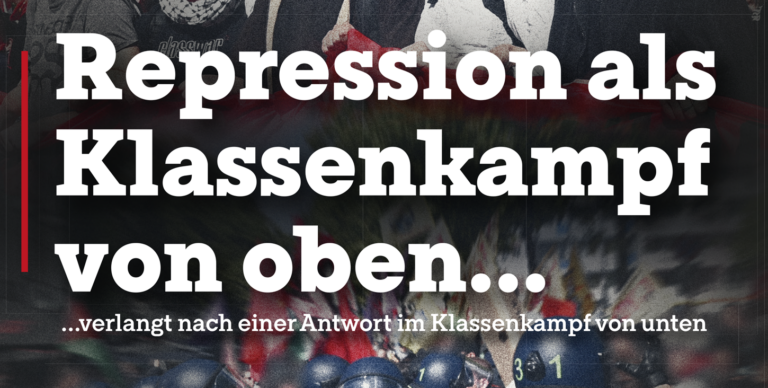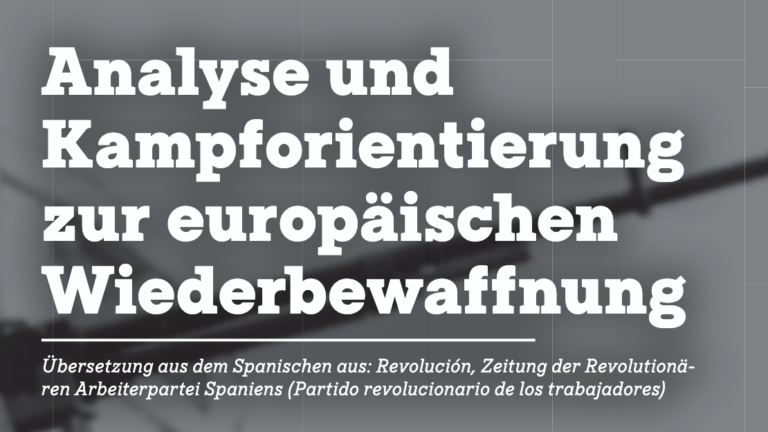Aus: Klassenkampf #3
Der grundsätzlich internationale Charakter der sozialistischen Revolution dürfte unter Kommunist:innen wohl kaum umstritten sein. Wie sich dieser Charakter jedoch in der Strategie und Taktik sowie der alltäglichen Praxis und der Ausrichtung der Arbeit von Kommunist:innen in Deutschland und international in den vergangenen 150 Jahren wie heute konkret ausdrückt, war und ist hingegen eine heiß umstrittene Frage.
Wir wollen uns in diesem Text genau dieser Frage widmen und damit analysieren, welche grundsätzlichen strategischen, aber eben bereits heute relevanten konkreten Schlussfolgerungen sich aus der internationalen Perspektive der sozialistischen Revolution für uns ergeben.
Bei unserer Untersuchung gehen wir von den historischen Erfahrungen und den ideologischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus aus und bringen diese mit der Entwicklung des Imperialismus in den vergangenen Jahrzehnten zusammen. Anhand dieser Grundlagen wollen wir dann konkret schauen, welche Rückschlüsse wir für den heutigen Kampf für die sozialistische Revolution, für unsere Strategie und Taktik und die Ausrichtung unserer Arbeit hier und heute im imperialistischen Deutschland ziehen können.
Dabei werden wir einen Schwerpunkt auf die Frage legen, inwieweit die heutigen Bedingungen des imperialistischen Weltsystems die Möglichkeiten der Entstehung einer regionalen sozialistischen Revolution steigern und in welchen Punkten diese Perspektive weiterhin begrenzt bleiben muss. Dazu werden wir uns zudem historische Beispiele regionaler revolutionärer Situationen, Aufstände und Revolutionen anschauen.
In unseren Schlussfolgerungen wollen wir dann abschließend festhalten, welche Konsequenzen sich aus den Untersuchungen ergeben:
- Spielen die untersuchten Fragen heute nur auf taktischer Ebene eine Rolle oder auch auf strategischer? Also ändert sich z. B. dadurch unsere Revolutionsstrategie heute oder nur die Bedeutung von internationaler Bündnisarbeit?
- Wir sehen die Internationalisierung der Produktion, der Wirtschaft, Politik, der Medien und Co. Doch wie sieht es mit der internationalen revolutionären Organisierung und dem Aufbauen von Kämpfen aufeinander aus? Wie können sich vereinzelte nationale Kämpfe gegenseitig beeinflussen und stärken?
- Welche Rolle spielt der internationale Kampf des Proletariats gegen internationale imperialistische Bündnisse, wie die EU und die NATO?
Voraussetzungen der sozialistischen Revolution
Als Kommunist:innen sind wir Internationalist:innen und wollen nicht nur in unserem eigenen Land den Sozialismus erkämpfen, sondern streben letztendlich in einem weltrevolutionären Prozess die Überwindung des Kapitalismus auf Weltniveau an. Denn letztlich kann der Sozialismus nur siegen, imperialistische Überfälle und eine Restauration des Kapitalismus unterbunden werden und zum Kommunismus übergegangen werden, wenn dies auf der ganzen Welt geschieht. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern war unter anderem die erklärte Grundlage und das Ziel der Kommunistischen Internationale, die dies am 1. September 1928 in ihrem Programm festhielt:
„Das Endziel, das die Kommunistische Internationale erstrebt, ist die Ersetzung der kapitalistischen Weltwirtschaft durch das Weltsystem des Kommunismus. Die kommunistische Gesellschaftsordnung, die durch den ganzen Ablauf der geschichtlichen Entwicklung vorbereitet wird, ist der einzige Ausweg für die Menschheit, denn nur diese Gesellschaft vermag die fundamentalen Widersprüche des kapitalistischen Systems aufzuheben, die die Menschheit mit Entartung und Untergang bedrohen.“1
Von dieser Zielsetzung ausgehend, stellt sich die Frage, wie wir von einzelnen nationalen Klassenkämpfen gegen die Auswirkungen des Kapitalismus zum Weltkommunismus kommen. Da die Ungleichmäßigkeit der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung ein grundlegendes Entwicklungsgesetz des Kapitalismus ist, das auf der ständigen Konkurrenz der Kapitalist:innen untereinander, der Ausbeutung der schwächer entwickelten Länder durch die imperialistischen Staaten und dem dauerhaften Kampf dieser untereinander um die Weltherrschaft beruht, kann die internationale sozialistische Revolution nicht als ein einmaliger, gleichzeitiger weltweiter Akt verstanden und erwartet werden.2 Dies gilt umso mehr, da die ungleichmäßige Entwicklung der Länder im Kapitalismus insbesondere auch den Auf- und Abstieg verschiedener Länder mit einschließt und nicht nur in eine Entwicklungsrichtung verstanden werden darf.
Vorstellungen von der sozialistischen Revolution als gleichzeitiger Akt, wie sie in der kommunistischen Weltbewegung immer wieder als schädliche Abweichung auftauchen, führen letztendlich zu einer Passivität und einem Warten darauf, dass sich die objektiven und subjektiven Bedingungen in allen Ländern der Welt gleichzeitig auf eine revolutionäre Situation hin entwickeln. Da dies aufgrund der ungleichmäßigen Entwicklung jedoch niemals passieren kann, warten ihre Unterstützer:innen ihr Leben lang vergebens auf dieses Ereignis und verdammen damit ihre Anhänger:innen dazu, Zuschauer:innen im Klassenkampf zu werden. Mit dem Übergang des Kapitalismus in die Epoche des Imperialismus und durch seine weitere Entwicklung verschärft sich die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung einzelner Länder und Kapitale in immer höherem Maße.
Ausgehend von diesen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und den historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts können wir festhalten, dass der Sieg der sozialistischen Revolution und der Übergang zum Aufbau des Sozialismus zuerst in einer Gruppe von Ländern in einer Region oder selbst in einem kapitalistischen Lande allein möglich und machbar ist. Gleichzeitig sind die langfristigen Schwierigkeiten und Probleme nicht zu unterschätzen, die bei einer erfolgreichen Revolution in einem Land im Aufbau des Sozialismus auf dieses zukommen würden, sollte es dauerhaft alleine und isoliert sein. Hier wird es vor allem darum gehen, so schnell wie möglich eine Unabhängigkeit (Autarkie) in allen strategischen Bereichen der Produktion und Versorgung aufzubauen, um nicht in Abhängigkeitsverhältnisse zu kapitalistischen Staaten zu geraten. Aber jeder derartige Sieg in einem begrenzten Teil der Welt erweitert die Basis der Weltrevolution massiv und verschärft dadurch noch mehr die Krise des Kapitalismus. Je mehr Länder sich durch eine erfolgreiche Revolution und die Überwindung der Herrschaft der Monopole dem Lager des Sozialismus anschließen und damit den Weltmarkt des Kapitalismus verkleinern und eine sichtbare Alternative bilden, desto größer und tiefer wird die Krise des Kapitalismus und umso mehr wird seine Existenz letztlich selbst in Frage gestellt. Die dadurch entstehende Ausweitung der Diktatur des Proletariats, durch den Sieg des Sozialismus in einzelnen Ländern oder Regionen, legt die Grundlage für die Diktatur des Weltproletariats, welche die notwendige und entscheidende Vorbedingung des vollständigen Übergangs von der kapitalistischen zur sozialistischen Weltwirtschaft ist.
Bei einer solchen Entwicklung ist es notwendig, „dass die neu entstehenden proletarischen Republiken sich mit den bereits bestehenden verbünden, dass das Netz dieser Föderationen – das auch die das imperialistische Joch abwerfenden Kolonien mit einbezieht -, ständig wächst und dass diese Föderation schließlich zur Union der Sozialistischen Räterepubliken der Welt werden, die den Zusammenschluss der Menschen unter der Hegemonie des staatlich organisierten Weltproletariats verwirklicht.“3
Die Kommunistische Internationale ging weiter davon aus, dass die Revolutionen in verschiedenen Ländern nicht nur nicht zur selben Zeit passieren, sondern auch in ihrer Art bzw. von ihrem Charakter her unterschiedlich und eben nicht rein proletarische Revolutionen sein würden:
„Die internationale Revolution des Proletariats besteht aus einer Reihe ungleichzeitiger und ungleichartiger Prozesse: rein proletarische Revolutionen; Revolutionen von bürgerlich-demokratischem Typus, die in proletarische Revolutionen umschlagen; nationale Befreiungskriege und koloniale Revolutionen. Erst am Ende seiner Entwicklung führt dieser revolutionäre Prozess zur Weltdiktatur des Proletariats.“4
Die im Programm der Kommunistischen Internationale festgehaltene strategische Ausrichtung fasste die ideologischen Standpunkte und historischen Erfahrungen der Kommunistischen Weltbewegung bis zum Jahr 1928 zusammen. Sie verallgemeinerten damit etwa die Erfahrungen der russischen Oktoberrevolution und der missglückten regionalen Ausweitung dieser auf den europäischen Kontinent, insbesondere in den revolutionären Kämpfen 1918-1923. Die russischen Kommunist:innen gingen damals davon aus, dass man wenigstens in Deutschland ebenfalls mit der Revolution siegen müsste, damit sich die Diktatur des Proletariats dauerhaft in Russland halten und man den Sozialismus aufbauen könne. Dafür war man etwa im Herbst 1923 auch bereit die Rote Armee zur Unterstützung zu schicken und einen Krieg mit Polen, Frankreich und weiteren Staaten zu riskieren, die sich der Ausbreitung der Revolution in den Weg stellen würden.5
Aus der weiteren Entwicklung der Geschichte wissen wir, dass dieser Versuch der regionalen Ausbreitung 1923 vorerst scheiterte und damit für die folgenden Jahre die seit 1917 anhaltende Offensive des internationalen Proletariats endete. Erst mit dem Zweiten Weltkrieg und unter den besonderen politischen und ökonomischen Bedingungen, die durch Krieg und Faschismus und den heroischen Kampf der Roten Armee und der Arbeiter:innenklasse der besetzen Länder entstanden, konnte das sozialistische Lager auf ein Drittel der Welt ausgeweitet werden.
In der Folge von inneren und äußeren Widersprüchen und Einflüssen entwickelten sich die Sowjetunion und die sozialistischen Aufbauversuche in anderen Ländern jedoch bereits ab Mitte der 50er-Jahre und noch einmal verstärkt in den darauf folgenden Jahrzehnten weg von einer sozialistischen Entwicklung hin zur Restauration kapitalistischer Verhältnisse und dem Neuentstehen von Ausbeutungsverhältnissen.
Die Grundlage der revolutionären Situation
Mit Ausnahme der oben benannten besonderen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und der Befreiung der vom Faschismus besiegten Länder, kann die Arbeiter:innenklasse nur durch eine sozialistische Revolution in einer revolutionären Situation siegreich die Macht erringen und die Diktatur der Kapitalist:innen brechen. Der Versuch einer sozialistischen Revolution ohne das Vorliegen einer revolutionären Situation muss letztendlich scheitern, wobei auch die Entstehung einer revolutionären Situation noch lange nicht automatisch zur Revolution oder gar zu ihrem Sieg führt.
Lenin beschreibt die revolutionäre Situation als eine gesamtnationale Krise sowohl der ausgebeuteten als auch der ausbeutenden Klassen. Damit es zur revolutionären Situation kommt, genügt es in der Regel nicht, dass die „unteren Schichten» in der alten Weise „nicht leben wollen», es ist zudem erforderlich, dass die „oberen Schichten» in der alten Weise „nicht leben können», so Lenin. Dazu muss sich die Not der unterdrückten Klassen „über das gewöhnliche Maß hinaus“ verschärfen, die Aktivität der Massen erheblich steigern und sie müssen dadurch zu „selbstständigem historischem Handeln gedrängt werden“.
Gleichzeitig betont Lenin, dass „nicht aus jeder revolutionären Situation eine Revolution entsteht, sondern nur aus einer Situation, in der zu den oben aufgezählten objektiven Wandlungen noch eine subjektive hinzukommt, nämlich: die Fähigkeit der revolutionären Klasse zu revolutionären Massenaktionen, die genügend stark sind, um die alte Regierungsgewalt zu zerschlagen (oder zu erschüttern), die niemals, selbst in der Epoche der Krisen nicht, ‚fällt‘, wenn man sie nicht ‚fallen läßt‘.“6
Damit erteilt Lenin gleichzeitig all jenen eine Absage, die hoffen oder daran glauben, dass die Krisen des kapitalistischen Systems dazu führen könnten, dass dieser von alleine zusammenbrechen und eine neue Gesellschaft aufgebaut werden könnte, ohne zuvor einen organisierten revolutionären Kampf gegen das alte System zu führen und zu gewinnen. Während die kapitalistische Klasse gerade in der tiefsten Krise alles in ihrer Macht stehende tun wird, um das alte System am Leben zu halten, muss auch die Arbeiter:innenklasse in der revolutionären Situation bereit sein, alle Kräfte auf ihrer Seite zu mobilisieren und in den revolutionären Kampf zu führen.
Reserven für und gegen die Revolution
Die beiden sich in diesem Kampf um die Macht gegenüberstehenden Klassen müssen dabei versuchen, neben ihren eigenen Klassenkräften möglichst weitere gesellschaftliche Schichten als direkte oder indirekte Reserven zu mobilisieren, um damit ihre Kräfte im Klassenkrieg aufzustocken oder aber zumindest als Reserven der Gegenseite auszuschalten.
Klassische direkte Reserven, um deren Unterstützung die revolutionäre und konterrevolutionäre Klasse in der Revolution kämpfen, sind die schwankenden kleinbürgerlichen Zwischenklassen und Schichten. Dazu gehören insbesondere in den entwickelten imperialistischen Ländern auch die Schichten der Arbeiter:innenaristokratie.
Potentielle Verbündete der sozialistischen Revolution in Deutschland sind dabei heute insbesondere die Kleinbürger:innen und die halbproletarischen Zwischenschichten. Hierzu zählen unter anderem das klassische Kleinbürger:innentum aus kleinen Bäuer:innen, kleinen Gewerbetreibenden und selbstständigen Handwerker:innen sowie kleinen Beamt:innen und kleinen Selbstständigen. Daneben gibt es heute ein wachsendes modernes Kleinbürger:innentum, vor allem aus den leitenden Angestellten mittlerer Ebenen in den größeren kapitalistischen Unternehmen und Monopolen sowie den besser gestellten Freiberufler:innen.
Eine Voraussetzung für die Mobilisierung und Bindung dieser Reserven an die Vorhut der Arbeiter:innenklasse ist die Zerschlagung bzw. Entzauberung ihrer Träume vom Aufstieg im kapitalistischen System. Dafür müssen sie realisieren, dass ihr dauerhaft drohender Abstieg in die Arbeiter:innenklasse durch Wirtschaftskrisen, die Gesetze der kapitalistischen Konkurrenz und die für sie ökonomisch unhaltbaren Bedingungen, die ihnen von Banken und Monopolen diktiert werden, hervorgerufen wird. Die Aufgabe der Vorhut der Arbeiter:innenklasse ist es, ihnen ihre falschen Illusionen in das kapitalistische System anhand ihrer eigenen Lebensrealität vor Augen zu führen und damit die ideologische Anziehung, die die Kapitalist:innenklasse auf sie ausübt, und den Drang an ihrem eigenen unhaltbaren Status quo festzuhalten zu brechen und sie in den Klassenkampf auf Seite der Revolution zu integrieren.
Als weitere direkte strategische Reserven der Revolution analysiert Stalin als Verallgemeinerung aus den russischen Revolutionserfahrungen in seinem Werk „Über die Grundlagen des Leninismus“ unter anderem „b) das Proletariat der benachbarten Länder; c) die revolutionäre Bewegung in den Kolonien und abhängigen Ländern“.7 Als indirekte Reserven nennt er die Ausnutzung der Widersprüche und Konflikte der nichtproletarischen Klassen im eigenen Land, um den Gegner zu schwächen und die Ausnutzung der Konflikte, Kriege und Widersprüche zwischen den dem proletarischen Staat feindlich gesinnten bürgerlichen Staaten.
Spiegelbildlich kann man die herrschende Klasse der benachbarten Länder und konterrevolutionären (z. B. faschistischen und religiös-fundamentalistischen) Bewegungen als strategische Reserven der Konterrevolution verstehen und muss diese mit einberechnen. Das zeigte sich auch nach der sozialistischen Oktoberrevolution und dem darauf folgenden Bürgerkrieg, als die internationale Bourgeoisie jede konterrevolutionäre Bewegung in und um Russland herum befeuerte und zum Angriff auf die Revolution führte. Hinzu kamen reguläre Interventionstruppen aus rund zwei Dutzend Staaten, welche die Revolution zerschlagen und Russland unter sich aufteilen wollten.
Aus diesen Erfahrungen lernend, müssen wir uns auch für einen zukünftigen neuen Anlauf für die sozialistische Revolution die Frage nach der Bedeutung dieser Reserven und der auf sie einwirkenden Veränderungen des Imperialismus in den vergangenen 100 Jahren stellen.
Dabei wollen wir sowohl aufbauend auf den allgemeinen Analysen der Entwicklungen des imperialistischen Weltsystems und der europäischen und deutschen Wirtschaft im Besonderen als auch aus historischen Erfahrungen erste Schlussfolgerungen für die heutige strategische Bedeutung dieser Reserven für die sozialistische Revolution in Deutschland ziehen.
Politische und gesellschaftliche Entwicklungen
Nach dem Blick auf diese Grundlagen wollen wir nun analysieren, wie sich der Imperialismus in den vergangenen mehr als 100 Jahren seit Lenins Imperialismus-Analyse und den programmatischen Grundsätzen der Kommunistischen Internationale entwickelt hat und welche Bedeutung diese Entwicklungen für den internationalen Charakter der sozialistischen Revolution und insbesondere die Frage der regionalen Reserven haben.
Die Entwicklung des Imperialismus
Während Lenin in seinem Werk „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ den Imperialismus in einem noch sehr frühen Stadium seiner Entwicklung beschrieben hat, so hat er sich seit dem weiter ausgebreitet und entwickelt. Heute können wir viele der in diesem Werk für einzelne Länder beschriebenen Charakteristika auf weltweitem Niveau voll ausgereift sehen, die Lenin zu seiner Zeit nur in Ansätzen beschreiben konnte. Dazu zählt etwa die allgemeine Tendenz zur Monopolbildung auf allen Ebenen der kapitalistischen Produktion auf Weltniveau.
Heute ist der Kapitalismus überall auf der Welt die vorherrschende Produktionsweise und wir leben in einem imperialistischen Weltsystem, das imperialistische Staaten verschiedener Einflussstärke und abhängige, neokolonial und kolonial unterdrückte Staaten umfasst. Der Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus treibt dabei den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung durch die Weltmonopole und das Finanzkapital auf die Spitze.
Die Erschließung so gut wie jedes Fleckchens Land auf unserem Planeten, die Globalisierung der Produktion durch nahezu vollständige Einbeziehung dieser in die Weltwirtschaft sowie die Internationalisierung von Produktionsketten hat zu einem einheitlichen Weltmarkt geführt, auf dem sich die imperialistischen Mächte und Weltmonopole dauerhaft in Konkurrenz gegenüberstehen und miteinander um Einflusssphären, Zugang zu Rohstoffen und Absatzmärkten kämpfen.
Durch die dauerhafte kapitalistische Überproduktion, die Konkurrenz untereinander, die Ungleichentwicklung der einzelnen Länder und Monopole und die dauerhaft bestehenden widerstreitenden Interessen der verschiedenen Kapitale wird das imperialistische Weltsystem immer wieder durch gigantische Krisen erschüttert. Seit 2008/2009 befindet sich darüber hinaus das aktuelle Modell der globalen Produktion in einer langanhaltenden Krise.8
Diese hoch vernetzte und internationalisierte Produktion führt sowohl zu einer gegenseitigen Durchdringung und Verzahnung einzelner nationaler Wirtschaften als auch zu einer gesteigerten gegenseitigen Abhängigkeit dieser von einander. So konnten wir in den vergangenen Jahren immer wieder sehen, wie eine plötzliche Störung des internationalen Waren- und Handelsverkehrs zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen auf dem Weltmarkt führte und starke Folgen für jeweils zahlreiche Länder hatte.
Auch wenn die Gründe für diese Erschütterungen jeweils unterschiedlich waren (Verstopfung des Suez-Kanals, Folgen der Corona-Pandemie-Politik, Störung des Handels mit russischem Öl und ukrainischem Getreide in Folge des Russland-Ukraine-Kriegs, Wirtschaftssanktionen und Zollkriege), so zeigen sie doch die massive Anfälligkeit der heutigen globalisierten Produktion. Zudem führen die sich immer weiter und schneller zuspitzenden Widersprüche zwischen den großen imperialistischen Ländern und die immer offener ausgefochtenen Machtkämpfe zwischen regionalen Mächten zur Ausweitung regionaler Kriegs- und Konfliktregionen und einer steigenden Weltkriegsgefahr.
Infolge dieser Entwicklungen versuchen die Imperialisten bereits seit einigen Jahren, die Verzweigung der Weltwirtschaft ein Stück weit zu entwirren, sich dauerhaften und exklusiven Zugang zu den wichtigsten Rohstoffen und Produktionszweigen zu verschaffen und die internationalen Produktionsketten wo möglich zu verkürzen und zu regionalisieren, um sie weniger störanfällig und besser verteidigbar zu machen. Dies sehen wir etwa bei den Diskussionen um die Förderung Seltener Erden im eigenen Land, auch wenn dies deutlich teurer ist als in anderen Ländern, oder den Versuchen der Ansiedlung von Chip- und Batterieindustrie in Deutschland, den USA und Japan. Der größte Teil insbesondere leistungsstarker Hightech-Mikrochips wird heute ausschließlich in Taiwan produziert – vor dem Hintergrund eines möglichen Kriegs mit China wohl eine der größten Achillesfersen der internationalen Produktion.
Doch die internationalisierte Produktion hat auch weitere Effekte, die sich auch jenseits der direkten Produktionssphäre auf das Leben der Menschen auswirken.Dazu gehört etwa die technologische Entwicklung der Kommunikationsmittel und ein dadurch schnellerer Informationsaustausch zwischen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt. So kommt es auch zu einer stärkeren Vernetzung der Massen durch Internet und Medien. Bei einer Umfrage der Bundesnetzagentur gaben 2023 90% der über 16-jährigen an, Online-Kommunikationsdienste zu nutzen.9 Informationen werden nicht mehr stark zeitversetzt und nach „Nachrichtenwert“ gefiltert verbreitet, sondern gehen quasi in Echtzeit durch die Welt und dies kann nur noch durch einen sehr hohen Aufwand überhaupt verhindert werden. Gleichzeitig steigt damit auch die schnellere und vermehrte Verbreitung von „Fake News“ (falschen Nachrichten). Die Entwicklung moderner Kommunikationsmittel und ihre steigende Bedeutung für Produktion und Klassenkampf, für Kapitalist:innen und Arbeiter:innenklasse, ist daher Fluch und Segen zugleich.
Regionale Verflechtungen
Auch wenn Deutschland den USA und China als mächtigsten imperialistischen Ländern der Welt in einigem nachsteht, nimmt es den Status einer der wichtigsten darauffolgenden Mächte der Welt ein. Es hat eine breit aufgestellte ökonomische Basis, das drittgrößte nominelle Bruttoinlandsprodukt der Welt10 und ist in der Lage, sich im internationalen Konkurrenzkampf mit einer eigenen Strategie am Kampf um die Welthegemonie zu beteiligen. Das heißt, es ist aufgrund seiner Machtstellung gegenüber einer großen Anzahl von Staaten weltweit in der Lage, seine Interessen durchzusetzen und ist dabei nicht nur z. B. auf eine bestimmte Region begrenzt.11
Eine besondere Rolle für den deutschen Imperialismus spielt die Europäische Union (EU). Als imperialistisches Bündnis nutzt Deutschland die EU zur Durchsetzung seiner Interessen in Europa und darüber hinaus. Die EU ist ein zentrales Mittel zur Ausübung von politischem Einfluss und zum Ausspielen seiner wirtschaftlichen Überlegenheit für den deutschen Imperialismus. Sie ist dabei ein zeitweiliges imperialistisches Bündnis, das sich über Jahrzehnte aus den widersprüchlichen imperialistischen Kräfteverhältnissen in Europa herausgebildet hat und dauerhaften Veränderungen im Konkurrenzkampf der Imperialisten unterworfen ist. Neben Deutschland und seinen imperialistischen Konkurrenten schließt sie auch abhängige Staaten ein, die vom imperialistischen Kapital zunehmend ökonomisch durchdrungen und von den dazugehörigen Staaten in politische Abhängigkeit gebracht werden.
Durch die jahrzehntelange Existenz und Entwicklung dieses Bündnisses haben sich innerhalb und zwischen den Mitgliedsländern der EU besondere politische und wirtschaftliche Verbindungen und Verflechtungen gebildet und verfestigt. Auch wenn die EU als imperialistisches Bündnis von den Widersprüchen und sich entgegenstehenden Interessen insbesondere der wirtschaftlich stärksten Mitgliedsstaaten geprägt ist, fördern ihre Abkommen und Richtlinien die Entstehung eines innereuropäischen Wirtschaftsmarkts mit möglichst freiem Waren- und Kapitalverkehr. Mit der EU betreffen die innerhalb ihrer Bürokratie getroffenen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen gleichzeitig ein mit dem Bündnis wachsendes immer größeres Gebiet und ebenso die Arbeiter:innenklasse zahlreicher Länder.
Ähnliche Entwicklungen sehen wir auch in anderen Regionen der Welt, in denen die wirtschaftliche Integration durch regionale imperialistische Bündnisse und kapitalistische Freihandelsabkommen zu einer gegenseitigen wirtschaftlichen Durchdringung bzw. einem Verwachsen von Wirtschaftsräumen kommt, was dann eben auch ähnliche wirtschaftliche Entwicklungen und einen größeren kulturellen Austausch in der Region fördert.
Doch nicht nur die geographische Nähe und ökonomische Verschränkung der Wirtschaftsräume führen zu einer größeren regionalen Vernetzung, sondern auch die ähnlichen Kulturkreise und ihre regionale Entwicklung verstärken und stützen diesen Faktor. Das können wir zum Beispiel in Regionen wie Westeuropa, dem Balkan, in Teilen Nordafrikas und Westasiens, in Südamerika etc. sehen.
Das Zusammenkommen ähnlicher Kulturkreise (z. B. gleiche oder ähnliche Sprache, Religion, Gebräuche), gemeinsamer Medienlandschaften und Kommunikationsmittel sowie einer stark gegenseitig verzweigten Wirtschaft führt auch dazu, dass größere soziale, politische und ökonomische Protestbewegungen immer häufiger nicht mehr nur auf ein Land konzentriert sind, sondern sich sehr schnell regional oder sogar international ausbreiten. Die Gründe dafür sind ein Zusammenspiel der einfacheren Kommunikation, ähnlicher Lebenslagen und den selben ökonomischen und politischen Problemen, die die Menschen auf die Straße treiben. Durch diese Entwicklungen kann heute der Funke des Protests und der Rebellion sehr schnell von einem lokalen Ereignis ausgehend überspringen und ganze Weltregionen in Aufruhr versetzen. Beispiele dafür gibt es in den vergangenen Jahren mehr als genug. Vom „Arabischen Frühling“ 2011, über die Gelbwestenbewegung und Bäuer:innen-Proteste in der EU, bis zu den Protesten gegen neoliberale Angriffe in Südamerika und der internationalen Solidaritätsbewegung mit Palästina.
Doch ist diese Entwicklung wirklich so neu und besonders? Sind es nur quantitative Veränderungen, welche die regionale und internationale Beeinflussung von Protesten und Aufstandsbewegungen häufiger vorkommen lassen und deren Auswirkungen vergrößern oder verändert sich dadurch auch ihre Qualität? Entstehen dadurch etwa regionale oder internationale revolutionäre Situationen? Und welche taktischen und strategischen Schlussfolgerungen können und müssen wir aus diesen Veränderungen für unsere politische Arbeit in Deutschland heute ziehen?
Beispiele für regionale Revolutionen, internationale Bewegungen und revolutionäre Situationen
Tatsächlich ist das Phänomen der sich gegenseitig beeinflussenden internationalen Proteste nicht so neu, wie es uns heute vielleicht scheinen mag. In einer Zeit, in der es, zumindest in den imperialistischen Zentren, überall verfügbares Internet und digitale Massenkommunikation gibt, kann sich manch einer wohl kaum eine internationale Bewegung ohne diese Informationsmittel vorstellen.
Historisch gibt es jedoch im 19. und 20., aber auch im frühen 21. Jahrhundert eine ganze Reihe an Ereignissen, bei denen man vom Vorliegen einer über den nationalen Rahmen hinausgehenden revolutionären Bewegung und Aufständen, meist im Rahmen von regionalen revolutionären Situationen ausgehen kann.
Verbunden wurden diese Bewegungen durch die selben objektiven Gründe für ihre Entstehung, die trotz der unterschiedlichen nationalen Entwicklung eben doch so ähnlich waren, dass sie dazu führten, dass in einem zeitlichen Zusammenhang über Ländergrenzen hinweg eine revolutionäre Bewegung mit ähnlichen oder sogar identischen gemeinsamen Forderungen und Zielen entstand, die sich jeweils gegen die Herrschenden im eigenen Land richteten. Diese Gründe liegen in einer ähnlichen, wenn eben auch nicht gleichen quantitativen und qualitativen Entwicklung der nationalen Ökonomien und dem parallel wachsenden Widerspruch zwischen der voranschreitenden Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Produktionsmitteln (Produktivkräfte) und der Verteilung des durch die Produktion geschaffenen Reichtums (Produktionsverhältnisse). Wir wollen uns einige dieser Bewegungen hier exemplarisch ansehen.
1848er Revolution: Die erste regionale Revolution?
Das Jahr 1848 ist durch eine Reihe von ineinandergreifenden Revolutionen in Europa in die Geschichte eingegangen. Ausgehend von Italien und Frankreich breitete sich die revolutionäre Welle über Deutschland, Österreich, Ungarn, Moldawien, Tschechien und weitere Regionen Europas aus. Gemeinsam hatten diese Revolutionen, dass es um die Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung ging. Die feudalen oder halbfeudalen Systeme sollten beseitigt, demokratische Rechte für die Masse der Bevölkerung erkämpft, parlamentarisch-demokratische Verhältnisse hergestellt und die feudalen Herrscher durch die aufstrebende bürgerliche Klasse ersetzt werden. Ihrem Charakter nach handelte es sich also um bürgerliche Revolutionen.
Bereits Ende des Jahres 1847 reiften in den verschiedenen Ländern Europas die Spannungen zwischen den verschiedenen Klassen und politischen Fraktionen immer weiter heran, sodass sie sich ab Januar 1848 gewaltvoll entluden und bis in den März hinein große Teile Europas erfassten.
Folge der Revolutionen waren nicht nur der Sturz bzw. Beschneidung der politischen Macht zahlreicher europäischer Königshäuser, sondern insbesondere die Bildung verschiedener bürgerlicher Nationalstaaten und die Durchsetzung bürgerlicher Rechte und Freiheiten.
Und doch blieben die meisten dieser Revolutionen auf halbem Wege stecken bzw. wurden im Blut der Konterrevolution erstickt. Ein Euphemismus, dass diese trotz allem als „Frühling der Völker“ in die bürgerliche Geschichtsschreibung eingingen. Ergebnis der revolutionären Kämpfe waren zwar eine Reihe von (zum Teil zeitlich begrenzten) Zugeständnissen an die revolutionären Massen. Doch in den meisten Ländern konnte sich die Konterrevolution in Form der alten Feudalklasse wieder durchsetzen, auch wenn sie bestimmte Zugeständnisse machen musste oder ein Bündnis mit der aufstrebenden bürgerlichen Klasse einging.
Friedrich Engels, der selbst aktiv an den revolutionären und bewaffneten Kämpfen in verschiedenen Regionen Deutschland teilnahm, beschreibt die Revolution von 1848 als europäische Revolution: „Die Revolution von 1848 war keine deutsche Lokalangelegenheit, sie war ein einzelnes Stück eines großen europäischen Ereignisses.“12 Laut Engels scheiterten nicht nur die einzelnen nationalen Kämpfe, sondern hätten ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten gehabt, wenn einzelne Revolutionen unter Führung der Arbeiter:innenklasse siegreich gewesen wären. So beschreibt er die Niederlage der revolutionären Kämpfe in Frankreich als strategische Niederlage für die Kämpfe in Deutschland und sah dadurch die Möglichkeiten eines isolierten Sieges in Deutschland für kaum mehr realistisch an.
1917-1919: Sozialistische Revolution & Räterepubliken
Die bisher wohl größte revolutionäre Welle erschütterte große Teile Europas in der Zeit rund um das Ende des Ersten Weltkriegs. Dazu zählen nicht nur die beiden erfolgreichen Revolutionen in Russland im Jahre 1917 (Februarrevolution und Oktoberrevolution), sondern auch die revolutionären Erhebungen in zahlreichen weiteren Ländern Europas in den Jahren 1918-1919. In einigen Ländern gingen die revolutionären Kämpfe und Revolutionsversuche bis in die beginnenden 1920er Jahre hinein.
In verschiedenen europäischen Ländern wie unter anderem Deutschland13, der Schweiz, Österreich, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei führten die revolutionären Erhebungen der Arbeiter:innen und Soldaten zu einem Ende des Krieges bzw. zur Gründung von Rätebewegungen, welche die Regierungen stürzten und zur kurzzeitigen Schaffung von revolutionären Räterepubliken, wenn meist auch auf lokaler Ebene. Eine dauerhafte revolutionäre Regierung und die Übernahme der staatlichen Macht im gesamten Land gelang jedoch nur in Ungarn für einige Monate.
Gemeinsam hatten alle diese Ereignisse, dass die Entstehung von revolutionären Situationen in den einzelnen Ländern nicht unabhängig voneinander passierte, sondern eine gemeinsame Ursache hatte. Der Weltkrieg hatte ganz Europa in ein Schlachtfeld verwandelt und letztlich dazu geführt, dass die Wirtschaft der europäischen Länder am Boden lag, das Maß des Leids der Bevölkerung und der an die Fronten geworfenen Arbeiter:innenklasse aller Länder sich bis aufs Äußerte zuspitzte und dadurch gleichzeitig die Herrschenden nicht mehr wie bisher ihre Herrschaft aufrecht erhalten konnten.
Durch den Erfolg der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland und dem darauf folgenden Ausscheiden Russlands aus dem Weltkrieg durch den Frieden von Brest-Litowsk im März 1918 wurde der „russische Weg“ zur leuchtenden Hoffnung und zum Vorbild für die Arbeiter:innenklasse der noch im Krieg stehenden europäischen Länder.
Die besondere Situation des Weltkriegs und die dadurch hervorgerufene Mobilisierung immer größerer Teile der männlichen Teile der Arbeiter:innenklasse schuf verschiedene revolutionäre Zentren. Sowohl die Großstädte und Regionen mit zentralen Industriestandorten, in denen sich die Not und Armut immer weiter zuspitzten, als auch die Städte mit den größten Armeestützpunkten entwickelten sich zu den wichtigsten revolutionären Zentren.
Eine besondere Schwäche, die dazu führte, dass letztendlich ein großer Teil der revolutionären Erhebungen in Europa in den Jahren 1918-1919 scheiterte oder aber bei den Erfolgen einer demokratischen Revolution (Abschaffung der Monarchie, Einführung demokratischer Rechte etc.) stehen blieb, war die Schwäche und Unerfahrenheit der kommunistischen Organisationen und der offene Verrat der alten Sozialdemokratie. Damit verging zunächst auch die Chance, die erfolgreiche sozialistische Revolution von Russland aus weiter auszubreiten. Auch weitere revolutionäre Erhebungen, wie die Märzrevolution im Ruhrgebiet und der Hamburger Aufstand scheiterten in den 1920er-Jahren als vorerst letzte ernsthafte Versuche, die Revolution auch in weiteren Ländern zum Erfolg zu führen.
Der historische Verrat der europäischen Sozialdemokratie der II. Internationale zu Beginn des Ersten Weltkriegs durch die Burgfriedenspolitik mit der eigenen herrschenden Klasse, ihr damit einhergehendes Übertreten auf die Seite des Imperialismus und die in den meisten Ländern zu späte Trennung der kommunistischen Kräfte und Gründung eigener Kommunistischer Parteien ohne die alte Sozialdemokratie, schwächte das Proletariat in der entscheidenden Phase des Weltkriegs und der daraus entstandenen revolutionären Situation. Der Versuch der russischen Kommunist:innen, dieser Entwicklung mit dem Zusammenschluss der europäischen kommunistischen Kräfte in der Zimmerwalder Linken ab 1915, welche später in der Gründung der III. Internationale (Kommunistische Internationale) im Jahr 1919 gipfelte, zu begegnen und so die Voraussetzungen für eine revolutionäre Beendigung des Krieges und seine Überführung in einen revolutionären Bürgerkrieg zu schaffen, konnte die zu geringe Erfahrung, Festigkeit und Verankerung der Kommunist:innen jedoch nicht entscheidend ausgleichen.
Die detaillierte Bewertung der Geschichte und Entwicklung der Kommunistischen Internationale und ihrer expliziten Konzeption als Weltpartei (Führung der gesamten Bewegung aus einem Zentrum heraus) kann an dieser Stelle nicht geleistet werden, sondern muss gesondert erfolgen. Gleiches gilt für die Beeinflussung der antikolonialen Kämpfe in den Kolonien und ihre Beeinflussung durch die erfolgreiche Oktoberrevolution und die revolutionären Kämpfe in den imperialistischen Ländern Europas 1918-1919.
Etwas anders als die beiden europäischen Revolutionswellen 1848 und 1918 lagen sicher die Gründe, Entstehungsgeschichte und Dimensionen der beiden folgenden Beispiele. Trotzdem wollen wir sie hier als Beispiele nennen, um aus diesen Erfahrungen und ihren Besonderheiten lernen zu können und den eigenen Horizont auch über eher „typische“ historische Beispiele hinaus zu erweitern und diese zu analysieren.
1968er-Bewegung
Die Entstehungsgeschichte und der Verlauf der internationalen 1968er-Bewegung ist in jedem Land zu einem bestimmten Grad unterschiedlich gewesen. Trotzdem liegen ihr einige gemeinsame Aspekte und internationale Ereignisse zugrunde, welche die parallele Entstehung dieser weltweiten Bewegung in der Mitte der 1960er Jahre möglich machte und die es für uns zu untersuchen gilt.
Gemeinsame Grundlage der Bewegung waren verschiedene starke Umbrüche, sowohl auf ökonomischer, als auch gesellschaftlicher und politischer Ebene, die Millionen Menschen dazu brachten, selber aktiv zu werden. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Beispielen können wir hier nicht von einer (einheitlichen) revolutionären Situation im klassischen Sinne ausgehen, sondern müssten das Vorliegen dieser genauer für einzelne Länder und Regionen der Welt betrachten und bestimmen, in welchen Aspekten eine solche überhaupt vorlag. Gleichzeitig sind gerade die revolutionären Kämpfe und Protestbewegungen der 1960er-Jahre von einer starken gegenseitigen Beeinflussung und Rückwirkung aufeinander geprägt.
Bedeutenden Einfluss auf das Entstehen und die Entwicklung der Bewegungen hatten dabei insbesondere folgende ineinander verschränkte und sich gegenseitig vertiefende Aspekte:
- Die erste größere Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg (ab 1967) erschütterte das „Wirtschaftswunder“ des seit zwei Jahrzehnten ununterbrochenen Wirtschaftswachstums sowie die Finanzmärkte bzw. das US-geführte Weltwährungssystem von Bretton-Woods, welches schließlich 1973 kollabierte. Damit wurde auch die Propaganda, dass der Kapitalismus das bessere System als der Sozialismus sei, direkt in Frage gestellt.
- Erstarken der Unabhängigkeits-, Befreiungs und Guerillabewegungen in zahlreichen Kolonien und ihre gegenseitige Stärkung und Beeinflussung; Einflüsse der kubanischen Revolution und der chinesischen Kulturrevolution.
- Entstehung eines breiten Antikriegs- und antiimperialistischen Bewusstseins insbesondere im Zuge der Kubakrise, des Vietnamkrieges, der 10 Jahre zuvor erfolgten Gründung der Bundeswehr und des Beitritts Deutschlands zur NATO.
- Infragestellung der herrschenden kulturellen und gesellschaftlichen Normen durch die erste Nachkriegsgeneration. Entwicklung und Verbreitung moderner Kommunikationsmittel und Medien.
- Erstarken der Bürgerrechtsbewegung in den USA, sowie Bewegungen für Demokratisierung und Modernisierung des Bildungsbereichs in zahlreichen Ländern.
- Diese und weitere Faktoren führten dazu, dass die 1960er- und der Anfang der 1970er-Jahre geprägt waren von zahlreichen Protest- und Aufstandsbewegungen, die mal mehr und mal weniger radikal das herrschende System in Frage stellten. Auch wenn revolutionäre und kommunistische Kräfte in den meisten Ländern die spontanen Bewegungen nicht dauerhaft anführen, lenken oder organisieren konnten, so haben die parallelen sozialen und politischen Bewegungen der 1960er-Jahre eine Welle gesellschaftlicher Umbrüche mit zentralen Forderungen nach Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Frieden und kultureller Freiheit hervorgebracht. Sie prägten das gesellschaftliche Klima nachhaltig, auch wenn viele ihrer konkreten Ziele nur teilweise erreicht wurden. Im Nachgang der 1968er Bewegung bildeten sich gerade in Deutschland zahlreiche unterschiedliche revolutionäre und kommunistische Organisationen, welche die Suche nach dem Weg zur sozialistischen Revolution in den folgenden Jahrzehnten prägen sollten.
Nationale Befreiungsbewegungen und Bewegungen in abhängigen Ländern
Nicht nur in der 1968er-Bewegung haben die nationalen Befreiungsbewegungen und Kämpfe in abhängigen Ländern ein bedeutende Rolle gespielt. Auch im Aufschwung der Aufstandsbewegung im Zuge der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 spitzten sich die Widersprüche insbesondere in den abhängigen Ländern besonders zu und führten hier zu entsprechenden Massenbewegungen gegen die imperialistische Ausbeutung und Unterdrückung. Bis heute setzen die Imperialisten und ihre Marionettenregime zur Aufrechterhaltung ihrer Besatzung, Ausplünderung und Unterdrückung zahlreicher Völker und Nationen immer wieder ganze Regionen in Brand und rufen damit ebenso Widerstand hervor.
In den vergangenen Jahren konnte man dies vor allem im Widerstand in Kurdistan und Palästina sehen. Der Kampf gegen imperialistische Unterdrückung und Besatzung hat hier immer wieder zu einem Flächenbrand in Westasien geführt, der sich nicht auf ein Land begrenzen lässt, sondern die gesamte Region ins Wanken gebracht hat und damit sowohl die bisherige Herrschaft als auch das Leben der Unterdrückten in Frage gestellt hat.
So hat der israelische Krieg nach den Angriffen am 7. Oktober 2023 sich nicht nur auf den Gaza-Streifen oder weitere palästinensische Gebiete beschränkt, sondern einen Krieg in der Region ausgelöst, der bis heute anhält und den Status quo der gesamten Region in Frage stellt. Insbesondere das Fehlen starker revolutionärer Kräfte in der Region und die fehlende Vereinigung der Unterdrückten im revolutionären Kampf verhindert dabei immer wieder einen stärker vereinten Kampf gegen alle Unterdrücker:innen in der Region.
Auch anhand der Entwicklungen in Kurdistan können wir sehen, dass die Versuche der regionalen Mächte die kurdische Nation zu spalten und in die verschiedenen unterdrückenden Nationalstaaten zu pressen und zu assimilieren keinen Erfolg haben, sondern regelmäßig Widerstand hervorrufen. Hier kämpfen seit Jahren kommunistische und fortschrittliche Kräfte um die Freiheit und Demokratisierung mit einer regionalen Perspektive. Dabei zeigen insbesondere die spontanen Bewegungen, wie die unter der Parole „Jin, Jiyan, Azadi!“ (Frau, Leben, Freiheit) entstandene Protestbewegung im Iran 2022 und ihre Ausweitung unter anderem auf die Türkei, Afghanistan, Syrien und den Irak oder die grenzüberschreitenden Widerstände unter anderem der in vier verschiedenen Staaten lebenden kurdischen Bevölkerung und der mit ihnen verbundenen nationalen Befreiungsbewegungen gegen die Ausbreitung des „Islamischen Staats“ und die Verteidigung der Städte Kobane und Sindschar 2013/2014 die regionale Dimension dieser Kämpfe.
Eine der wohl größten regionalen Protestbewegungen, welche in zahlreichen Regierungsstürzen gipfelte, waren die in westlichen Medien als „arabischer Frühling“ oder auch „arabische Revolution“ benannten Aufstände in zahlreichen Ländern in Nordafrika und Westasien im Jahr 2011, die als Folge der Auswirkungen der schlechten ökonomischen Situation der Länder Nordafrikas und Westasiens in Folge der Weltwirtschaftskrise entstanden waren.
Beginnend mit der Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi im Dezember 2010 in Tunesien breitete sich die Aufstandswelle in rasender Geschwindigkeit über alle Länder Nordafrikas, die arabische Halbinsel und zahlreiche Länder Westasiens aus. Unter anderem in Tunesien, Ägypten, Libyen und dem Jemen mussten die Regierungen im Rahmen der Proteste und Aufstände zurücktreten. Insgesamt fanden in mehr als 17 Ländern der Region größere Demonstrationen oder andauernde Proteste für mehr Demokratie und gegen die prekäre wirtschaftliche Situation der Arbeiter:innenklasse der Länder statt. Der „arabische Frühling“ ist wohl das anschaulichste aktuelle Beispiel für die gegenseitige Beeinflussung von Protesten, die zu einer regionalen revolutionären Situation geführt haben und nicht allein das herrschende System in einem Land, sondern einer gesamten zusammenhängenden Region ins Wanken gebracht hat.
Die mit diesen Aufständen verbundenen Hoffnungen wurden jedoch schnell enttäuscht. Auf die Proteste und Aufstände folgten nach einzelnen Zugeständnissen und Beschwichtigungen in der Mehrzahl der Länder eine enorme Repression und eine Stärkung islamisch-fundamentalistischer Kräfte anstatt einer dauerhaften Verbesserung der ökonomischen und politischen Situation der Arbeiter:innenklasse. Auch hier fehlten starke revolutionäre Kräfte, welche die Aufstände hätten dauerhaft zum Erfolg führen können. Eine Ausnahme waren hier alleine die oben bereits benannten kurdischen Kräfte in Syrien, die seitdem versuchen ein demokratisches Gegenmodell in Teilen des Landes zu organisieren und zu verteidigen.
Regionale Konterrevolution
Verbunden mit nationalen, aber insbesondere auch den verschiedenen aufgezeigten regionalen Aufstands- und Revolutionsversuchen, ist die regionale Reaktion der Konterrevolution auf diese. So sehr die Kapitalist:innen einzelner Unternehmen und die verschiedenen imperialistischen Staaten im unversöhnlichen Konkurrenzkampf zueinander stehen, so eint sie doch über alle unterschiedlichen und gegeneinander stehenden Eigeninteressen hinweg das Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer kapitalistischen Herrschaft und Ausbeutungsordnung als Ganzes.
Überall dort, wo der Aufstand gewagt wird, aber nicht erfolgreich ist oder nicht unermüdlich immer weiter geführt wird bis der Sieg tatsächlich gesichert ist und eine Phase der Stabilisierung der demokratischen oder proletarischen Herrschaft eingetreten ist, wird die Konterrevolution mit aller Macht zurückschlagen. Bereits Karl Marx und Friedrich Engels haben dies aus den ersten Revolutionserfahrungen der Pariser Kommune geschlussfolgert. Wo die Kommunarden zögerlich waren, wo sie zu sanft und gutmütig mit den Herrschenden umgegangen sind, haben sie nach der Niederschlagung der Kommune den doppelten Preis dafür gezahlt. Gleiches können wir auch bei der Bekämpfung regionaler Revolutionsversuche oder der regionalen Konterrevolution gegen die siegreiche Oktoberrevolution sehen.
Sowohl die Revolutionen 1848 als auch die Revolutionsversuche 1918-1919 und die demokratischen Aufstände im „arabischen Frühling“ verfehlten ihre Ziele und wurden in der Repression der Konterrevolution erstickt. Zeitweise oder auch dauerhafte positive Veränderungen, welche in den Aufständen erkämpft wurden, werden auf der anderen Seite durch noch reaktionärere Regime und die Stärkung der Konterrevolution beantwortet. So haben wir es zuletzt mit dem Aufstieg islamisch-fundamentalistischer Kräfte in zahlreichen arabischen Ländern nach dem Sturz der langjährigen Herrscherfamilien wie etwa in Tunesien gesehen.
Ideologische Diskussion über regionale und internationale Revolutionen
Die Diskussion, welche Schlussfolgerungen Kommunist:innen nun aus der Entwicklung des Kapitalismus und darauf aufbauend des Imperialismus als internationales bzw. weltweites System mit einem einheitlichen Weltmarkt ziehen, ist so alt wie die Entwicklung dieses Gesellschaftssystems selbst.
Wir wollen hier nicht in aller Ausführlichkeit die historische Diskussion um die Frage, inwieweit der „Sozialismus in einem Land“ möglich ist, nachzeichnen und bewerten. Dafür gibt es genug historische Texte und Analysen, sowohl von trotzkistischer als auch von kommunistischer Seite. Die Geschichte hat uns jedoch gezeigt, dass die Annahme der Bolschewiki richtig war, dass trotz aller Schwierigkeiten und Probleme der Sieg der sozialistischen Revolution und der Aufbau des Sozialismus in einem Lande möglich ist.
Lenin hat in seinem Text „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa“14 bereits 1915 ausführlich dargelegt, dass die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung einzelner Staaten ein unbedingtes Gesetz im Kapitalismus ist, aus dem sich die Möglichkeit und im Zweifel auch die Notwendigkeit ergibt, die sozialistische Revolution nur in einem Land durchzuführen.
Nach dem Sieg der Oktoberrevolution schrieb Lenin im August 1918 an amerikanische Arbeiter: „Wir wissen, es kann auch so kommen, daß die europäische proletarische Revolution nicht in den nächsten Wochen ausbricht, so schnell sie auch in letzter Zeit heranreift. Wir bauen darauf, daß die internationale Revolution unausbleiblich ist; das bedeutet aber keineswegs, daß wir törichterweise damit rechnen, die Revolution werde unbedingt innerhalb einer bestimmten kurzen Frist beginnen.“15
Die Bolschewiki setzten zwar stark darauf, dass die Revolution insbesondere in Deutschland und in möglichst vielen weiteren europäischen Ländern zeitnah erfolgreich sein würde, aber sie machten ihr Schicksal nicht von dieser Entwicklung abhängig. Stattdessen haben sie aus eigenen Kräften heraus einen Weg zum Aufbau des Sozialismus für sich entwickelt, während sie gleichzeitig sehr viele Kräfte in die Förderung der Ausdehnung der Revolution gesteckt haben. Doch als das scheiterte, haben sie mehr und mehr versucht, sich durch die Herstellung diplomatischer und Handelsbeziehungen auch mit den kapitalistischen Ländern den nötigen Spielraum für eine Weiterentwicklung ohne direkte kriegerische Konfrontation zu sichern. Die Bewertung dieser Entwicklung und dem Problem, dass damit mit der Zeit die Perspektive der internationalen Revolution immer weiter in den Hintergrund gerückt ist, müssen wir an anderer Stelle vornehmen.
Ganz anders gehen viele trotzkistische Gruppen, historisch wie heute, an diese Frage heran. Sie verstehen und propagieren die sozialistische Revolution als einen gleichzeitigen Aufstand der internationalen Arbeiter:innenklasse in einer Vielzahl an Ländern oder gar der gesamten Welt. In der Konsequenz gründen sie mit jeder Spaltung ihrer Bewegung dogmatisch und ohne eine konkrete Analyse und Bewertung der Bedingungen eine neue Internationale. Damit bauen sie letztendlich ihre Strategie darauf auf, dass sich in zahlreichen kapitalistischen Ländern zeitgleich eine revolutionäre Situation ergibt und der subjektive Faktor ebenso in all diesen Ländern parallel soweit entwickelt ist, dass es zum revolutionären Aufstand kommt. Sie verschieben damit in letzter Konsequenz die Revolution auf den Sankt-Nimmerleinstag.
Wie bereits oben dargelegt, hat die Entwicklung des Imperialismus zu einer immer verzweigteren und verschränkteren Entwicklung der Weltwirtschaft und gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den imperialistischen und kapitalistischen Ländern geführt. Diese Entwicklung hebt aber die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung in keinem Falle auf, sondern verschärft sie im Weltmaßstab weiter.
In dem kommunistischen Magazin „Marksist Teori“ aus der Türkei beschreibt Toprak Akarsu diese Entwicklung des Imperialismus heute wie folgt: „In der Zeit der imperialistischen Globalisierung gewinnt auch die lokale Dimension der Internationalisierung auf regionaler Ebene an Dynamik und der Wettbewerb durch regionale Integrationen wird charakteristisch. EU, Nafta und Shanghai Five spiegeln den regionalen Integrationstrend wider.“16
Anhand der Analyse der Entwicklung der Widersprüche und Klassenkämpfe in Nordafrika und Westasien zieht Akarsu daraus die Schlussfolgerung, dass „heute die regionale Revolution von Anfang an einen Platz im Programm und in der politischen Strategie des Proletariats finden muss. Das Ziel, schnell von Revolutionen einzelner Länder zu regionalen Revolutionen und von dort zur Weltrevolution überzugehen, ist ein aktuelles Problem, das auf der Tagesordnung steht und gelöst werden muss.“
Anknüpfend an den Vorschlag der Kommunistischen Internationale Anfang der 1920er Jahre, die Nationen des Balkans in einer sozialistischen Föderation zusammenzufassen, legt Akarsu in dem Artikel den Vorschlag zunächst von heute zu schaffenden antiimperialistischen Kampfkoordinationen der revolutionären und kommunistischen Kräfte auf dem Balkan und in Westasien mit dem Ziel, in einer regionalen revolutionären Situation die Kräfte zu bündeln, dar.
Für uns als Kommunist:innen in Deutschland bzw. Europa stellt sich die Frage, inwieweit diese Analyse auf unsere Region übertragbar bzw. anwendbar ist und ausgehend von den oben ausgeführten Beispielen regionaler Revolutionen und Aufstände, welche strategischen Schlussfolgerungen sich daraus heute ziehen lassen.
Europäische Revolution?
Ergibt sich aus den bisherigen Ausführungen für uns nun die strategische Ausrichtung auf eine zeitgleiche, vereinigte europäische Revolution? Ist der Klassenkampf dementsprechend nicht nur seinem Charakter nach, sondern auch seiner Form nach, heute international? Müssen wir dementsprechend unsere Organisationsformen, den Schwerpunkt unserer Agitation und Propaganda und die Richtung unseres Hauptschlages gegen den deutschen Imperialismus verändern?
Nein, so eine Schlussfolgerungen können wir aus den bisherigen Ausführungen natürlich nicht ziehen! Und damit würde man auch die Diskussion, welche die Genoss:innen von „Marksist Teori“ in ihrer Zeitung führten, von den Füßen auf den Kopf stellen oder bewusst entstellen, wie dies zum Teil in der theoretischen Diskussion dieser Frage als typisch dogmatischer Beißreflex in der türksichen revolutionären Bewegung gemacht wurde.
Solche Schlussfolgerungen zu ziehen würde bedeuten, eine Art „Ultraimperialismus“-Theorie17, wie sie Karl Kautsky 1914 entwickelte, zu adaptieren und das grundlegende Gesetz der Ungleichentwicklung der Staaten im Kapitalismus und seiner Verschärfung im Imperialismus zu negieren. Kurz gesagt: Es wäre eine Abkehr von der materialistischen Analyse der Realität hin zu einem idealistischen Gedankenkonstrukt, welches die zwingenden Widersprüche der kapitalistischen Ökonomie und die daraus hervorgehende unausweichliche dauerhafte Konkurrenz der Imperialisten verschleiern würde.
Betrachtet man zudem die historische, wie aktuelle Situation der verschiedenen Regionen, über die wir hier diskutiert haben genauer, so müssen hier wesentliche Unterschiede benannt werden, die in der Analyse und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen müssen. Während die Regionen Nordafrika, der Balkan und Westasien seit der Entstehung des Imperialismus geprägt sind von der Besatzung und Ausplünderung von Natur und Bevölkerung durch die imperialistischen Staaten, ist gerade Westeuropa genau durch das Gegenteil geformt worden. Die westeuropäischen Staaten und Ökonomien sind gerade durch ihre imperialistische Ausplünderung der Kolonien und der abhängigen Länder überall auf der Welt zu führenden Industrienationen geworden.
Die Völker auf dem Balkan, in Westasien und Nordafrika eint über die nationalen Grenzen hinweg ihr Interesse im Kampf gegen den Imperialismus. Sie haben damit nicht nur ihre nationale Bourgeoisie als Feind, sondern werden auf dem Weg zum Sozialismus eine Phase antiimperialistisch-demokratischer Kämpfe durchlaufen, in denen ihnen die imperialistischen Räuber als gemeinsamer Feind gegenüber stehen werden.
In Westeuropa und für uns in Deutschland ist diese Situation grundlegend anders. Egal wie sehr die Imperialisten durch zeitweilige imperialistische Bündnisse wie die EU, die NATO oder andere ihre Interessen bündeln und sich schwächere Staaten unterordnen, führt das nicht dazu, dass sich unser Kampf hauptsächlich gegen diese Bündnisse oder die herrschende Klasse anderer Länder richten würde. Unser Hauptfeind ist und bleibt der deutsche Imperialismus. Auch wenn wir zum Beispiel in der auf die Weltwirtschaftskrise folgende Staatsschuldenkrise in der EU gesehen haben, wie sich auch hier Proteste gegenseitig befeuern können.
Aus diesem zentralen Unterschied und den oben benannten Widersprüchen der kapitalistischen Entwicklung kann es keine prinzipielle strategische Neuorientierung auf eine gleichzeitige vereinigte europäische Revolution geben.
Was in unserer Strategie und Taktik jedoch bedacht werden muss, ist, dass bei der Entstehung einer parallelen revolutionären Situation in einer Reihe von europäischen Ländern die revolutionären Entwicklungen in den einzelnen Ländern sich gegenseitig direkt beeinflussen, so wie wir es in den obigen historischen Beispielen bereits gezeigt haben. Erfolgreiche Schlachten und Siege der Revolution in einem Land stärken die revolutionären Kräfte in anderen Ländern, wie konterrevolutionäre Rückschläge in einem Staat die Reaktion in anderen Staaten ermuntern und sie moralisch stärken.
Schlussfolgerungen für die revolutionäre Strategie
Doch was ergibt sich nun aus den bisher analysierten Grundlagen, Entwicklungen und historischen Erfahrungen, sowie heutigen Debatten für die Bedeutung des internationalen Charakters der sozialistischen Revolution im 21. Jahrhundert und insbesondere für uns in Deutschland?
Wir haben gesehen, dass die Frage der regionalen und auch der europäischen Revolution nicht neu ist und die Kommunist:innen bereits seit 200 Jahren immer wieder beschäftigt hat und es darauf ankommt, aus diesen Erfahrungen und Debatten richtige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Wir haben zudem gesehen, dass die Entwicklung des Imperialismus die gegenseitige ökonomische, politische und gesellschaftliche Durchdringung und Verzahnung der Länder in einer Region, aber auch weltweit, massiv zunimmt und Rückwirkungen auch auf die Frage der gegenseitigen Beeinflussung von Protestbewegungen, Aufständen und revolutionären Situationen hat.
Wir haben dabei jedoch auch festgehalten, dass diese Entwicklung eben nicht dazu führt, dass es international oder regional zu einer einheitlichen und gleichzeitigen ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklung kommt, die automatisch zu einer zeitgleichen Entstehung von revolutionären Situationen führt, auf die es zu warten gilt.
Für die revolutionäre Strategie der sozialistischen Revolution im Imperialismus und insbesondere für uns in Deutschland können wir daher feststellen, dass die Revolution weiter grundsätzlich national bleibt, auch wenn die gegenseitige Beeinflussung tendenziell wächst. Dies gilt insbesondere für verschiedene Regionen, die historisch, kulturell und gesellschaftlich eng verbunden sind und in denen sich dadurch zum Beispiel eine gemeinsame Medien- und Kulturlandschaft entwickelt hat, in der sich dauerhaft auch Protestkulturen gegenseitig positiv beeinflussen können oder wie in der EU eine politische oder ökonomische Krise des imperialistischen Bündnisses sich auf alle beteiligten Staaten auswirkt.
Auch wenn sich an der grundsätzlichen geographischen Revolutionsstrategie gerade aus der Analyse nichts ändert, so müssen wir doch trotzdem aus den Analysen Schlussfolgerungen für die konkrete Ausrichtung und Schwerpunktsetzung unserer Arbeit ziehen. So wird die regionale bzw. internationale revolutionäre Bewegung noch viel zu wenig als konkrete strategische Reserve der nationalen Revolution angesehen und entsprechend organisiert. Doch nur durch eine entsprechende Organisierung und Vorbereitung kann die mögliche Ausweitung von Protestbewegungen, Aufständen und Revolutionen in weitere Länder einer Region und dadurch auch die Spaltung und Schwächung der imperialistischen Kräfte gelingen.
Konkret heißt das für uns, dass wir davon ausgehen, dass aufgrund der engen politischen und militärischen Kooperation sowie der wechselseitigen ökonomischen Durchdringung der Kampf und Aufstand der Arbeiter:innenbewegungen in anderen europäischen Ländern und der gemeinsame internationale Kampf von wachsender Bedeutung für Sieg oder Niederlage der sozialistischen Revolution in Deutschland sein werden, da diese die strategische Reserve der Konterrevolution, die herrschende Klasse in ihrem Land, entschieden schwächt oder ganz ausschaltet. Dies gilt insbesondere da die objektiven Bedingungen und Möglichkeiten für das zeitlich eng beieinander liegende Entstehen revolutionärer Situationen in einer Region der kapitalistischen Weltwirtschaft durch die oben beschriebenen, dem Imperialismus eigenen, Entwicklungstendenzen gewachsen sind.
Nicht zuletzt im Ukrainekrieg haben wir mehr als deutlich gesehen, dass beim aktuellen Stand der Technik und der verzweigten imperialistischen Interessen und Wirtschaftsbeziehungen eine Begrenzung militärischer, ökonomischer und politischer Konflikte ab einer bestimmten Intensität kaum mehr möglich sind, sondern zu weltweiten Verwerfungen führen. Insbesondere dort, wo der Imperialismus tatsächlich in Gefahr gerät, wird aus jeder nationalen Erhebung schnell ein internationaler Kampf zwischen Revolution und Konterrevolution werden. Und dann dürfen die Arbeiter:innenklasse und die Kommunist:innen an ihrer Spitze eben nicht auf den Zuschauerrängen der Geschichte verharren, sondern müssen international ihren Platz im Kampf einnehmen.
Schon heute muss es uns daher darum gehen, die Vernetzung und die gemeinsame Praxis über die nationalen Grenzen hinweg auf- und auszubauen und einen Austausch von Erfahrungen und Organisierungs- und Kampfmethoden zu schaffen. Je besser wir international organisiert sind, je breiter unsere Kontakte und unsere gemeinsamen Kampferfahrungen auf regionaler und internationaler Ebene sind, desto besser sind wir auf die kommenden Kämpfe vorbereitet.
Die Notwendigkeit dieser Vernetzung und gemeinsamer Organisierung gilt natürlich im Besonderen für alle Gebiete, die strategisch für den deutschen Imperialismus sind und von diesem besonders ausgebeutet werden. Hier haben wir direkt einen gemeinsamen Feind, gegen den sich unser internationaler Kampf richtet. Dies gilt insbesondere in der EU, in der Deutschland eine Führungsrolle und die des Hauptprofiteurs einnimmt. Darüber hinaus gilt siefür die Balkanstaaten bzw. die Länder Osteuropas, in denen Deutschland historisch wie aktuell den größten und direktesten Einfluss als imperialistischer Ausbeuter einnimmt.18
Je mehr sich die zwischenimperialistischen Widersprüche (auch in Europa) zuspitzen, je größer die chauvinistische Propaganda gegen andere Länder und Nationen wird, desto wichtiger wird die Frage der regionalen und internationalen Vernetzung der revolutionären und kommunistischen Kräfte. Gerade in der Vorbereitungsphase eines neuen großen imperialistischen Verteilungskrieges ist es die Aufgabe der Kommunist:innen, eine internationale Praxis und Vernetzung dagegen zu entwickeln und einen erneuten Verrat am proletarischen Internationalismus wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs zu verhindern. Dafür müssen wir heute die ideologischen, politischen und organisatorischen Vorbereitungen treffen und ein entsprechendes Fundament legen.
Die sich daraus ergebende Frage einer konkreten internationalen Organisationsform, also etwa des Ziels der Neugründung einer Kommunistischen Internationale als Weltpartei und welche Schlussfolgerungen aus den gemachten Erfahrungen, ihren Stärken und Schwächen gezogen werden müssen, lassen sich nicht so einfach oder prinzipiell beantworten. Für eine Antwort auf diese Frage braucht es eine konkrete Auswertung der historischen Erfahrungen und eine konkrete Analyse der heutigen Bedingungen. Was sich jedoch als Schlussfolgerung festhalten lässt, ist, dass es eine deutlich gesteigerte Vernetzung und praktische Zusammenarbeit zwischen revolutionären und kommunistischen Organisationen und Parteien über Ländergrenzen hinweg braucht, damit diese die Rolle einer strategischen Reserve spielen und einen realen Unterschied im Klassenkampf machen können. Gleichzeitig wird die internationale Zusammenarbeit kommunistischer Kräfte immer auch verschiedene Organisationsformen beinhalten müssen und auf verschiedenen Ebenen stattfinden, die sich gegenseitig ergänzen müssen.
1Programm der Kommunistischen Internationale, Absatz III, Das Endziel der Kommunistischen Internationale: der Weltkommunismus
2Vgl. dazu mit detaillierten Ausführungen: W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW 22, Seite 189 ff.
3Programm der Kommunistischen Internationale, Absatz IV, Nr. 1 Die Übergangsperiode und die Eroberung der Macht durch das Proletariat
4Programm der Kommunistischen Internationale, Absatz IV, Nr. 8 Der Kampf für die Weltdiktatur des Proletariats und die Haupttypen der Revolution
5„Deutscher Oktober“, Dokument 9, Josef Stalin, Anmerkungen zum Charakter und zu den Perspektiven der deutschen Revolution, Moskau 20. August 1923, ebd., S. 111f
6W. I. Lenin, Der Zusammenbruch der II Internationale, LW Bd. 21, S. 206 f
7J. Stalin, Über die Grundlagen des Leninismus, Kapitel VII Strategie und Taktik, SW Bd. 6, S. 132 ff.
8Vgl. Smith, John (2016): Imperialism in the twenty-first century, Monthly Review Press, S. 279 ff.
9Nutzung von Online-Kommunikationsdiensten in Deutschland, Ergebnisse der Verbraucherbefragung 2023: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Digitales/OnlineKom/befragung_kurz23.pdf
10World Economic Outlook Database 2024, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/October
11Ausführlicher dazu in unserem Artikel „Die Entwicklung des deutschen Imperialismus“ in Klassenkampf Nr. 2
12Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg,MEW Bd. 7, S. 413.
13Vgl. https://komaufbau.org/100-jahre-novemberrevolution-100-jahre-kpd/
14Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa, Lenin Werke, Band 21, Seite 342-346
15Brief an die amerikanischen Arbeiter, Lenin Werke, Band 28, Seite 48-62
16Theoretische Voraussetzungen der regionalen Revolution, Ausgabe 20, März-April 2016, eigene Übersetzung, https://www.marksistteori5.org/93-marksist-teori/sayi-20-mart-nisan-2016/541-bolge-devriminin-teorik-onculleri.html
17Der Imperialismus, Karl Kautsky, Die Neue Zeit 32-II., 1914, 21, S.908-922. https://www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1914/xx/imperialismus.pdf
18Vgl. Der deutsche Imperialismus in Europa, https://komaufbau.org/deutscherimperialismus/