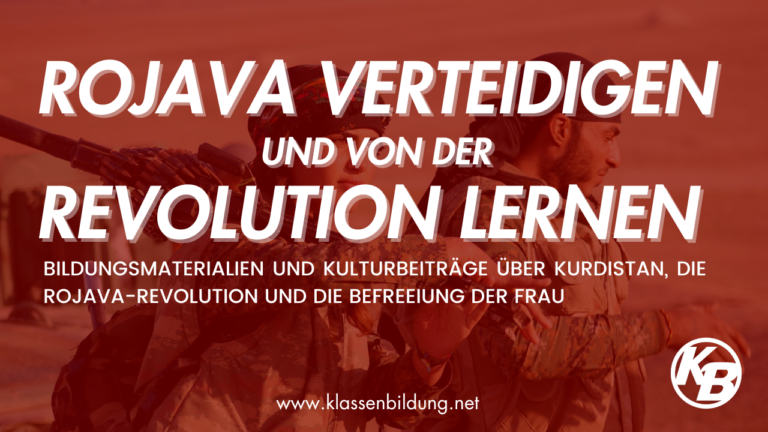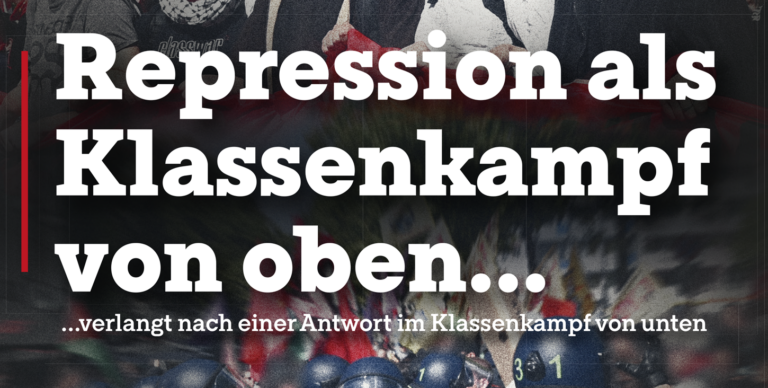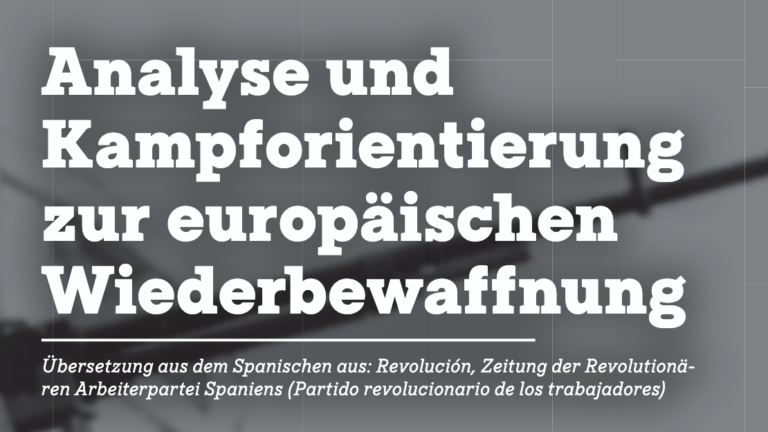„Welche Auffassungen sind es aber, die dem bürokratischen Denken und Handeln zugrunde liegen? Es sind Auffassungen, wonach die Apparate und ihre Beamten das Gesetz machen, leiten und kommandieren, über alles diktieren und beschliessen, während die breiten Massen des Volkes nur eine blinde Menge darstellen, die nur nach den Befehlen und unter dem Diktat der Bürokratie zu arbeiten und zu produzieren hat.“1 Diese Beschreibung des Bürokratismus stammt aus einem Mitte der 1970er Jahre erschienenen Artikel aus dem sozialistischen Albanien. Der Artikel arbeitet die zersetzende Rolle heraus, die der Bürokratismus in sozialistischen Gesellschaften spielen kann und betont die Notwendigkeit für Kommunist:innen, einen fortwährenden Kampf gegen diese überaus schädliche Erscheinung zu führen. In der Sowjetunion und anderen ehemals sozialistischen Ländern hatte das Wuchern bürokratischer Tendenzen dazu beigetragen, dass die sozialistische Gesellschaft ab den 1950er Jahren von den Revisionist:innen beseitigt und durch eine neue Klassengesellschaft ersetzt worden ist. Doch der Kampf gegen den Bürokratismus beginnt für Kommunist:innen nicht erst im Sozialismus. Der Staat, die Bürokratie und der Bürokratismus sind charakteristische Merkmale aller Klassengesellschaften und haben im Kapitalismus und Imperialismus eine neue Qualität eingenommen. Als Element der bürgerlichen Ideologie und des bürgerlichen Alltags sind auch die Arbeiter:innenklasse und die kommunistische Bewegung immer dem Einfluss des Bürokratismus ausgesetzt. Gerade in Deutschland gibt es eine gesellschaftlich fest verwurzelte Tradition des Bürokratismus, die auf den preußischen Staat zurückgeht und das Denken und Handeln der Menschen in diesem Land bis heute sehr stark prägt.
***
Definitionen: Bürokratie und Bürokratismus
Mit „Bürokratie“ bezeichnen wir die soziale Schicht der Beamt:innen und Angestellten, die im Staatsapparat, der staatlichen Exekutive und der Verwaltung arbeiten und die Gewalt des Staates gegenüber der Gesellschaft repräsentieren, darunter Staatssekretär:innen, Behördenmitarbeiter:innen und ebenso Angehörige von direkten Repressionsorganen wie Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten usw. Die Existenz der Bürokratie hängt an der Existenz des Staates in Klassengesellschaften und die Bürokratie ist damit immer ein Anhängsel der herrschenden Klasse. Beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft besteht die Aufgabe darin, die Klassen abzuschaffen. Da die Arbeiter:innenklasse bei der Bewältigung dieser Aufgabe auf den Staat, die Diktatur des Proletariats, angewiesen ist, wird es im Sozialismus auch immer eine gewisse Bürokratie geben. Im Kommunismus wiederum sind der Staat und die mit ihm entstandene Bürokratie abgestorben und es verbleiben die notwendigen Verwaltungsstrukturen zur Organisierung des gesellschaftlichen Lebens und Arbeitens.
Der Begriff „Bürokratismus“ bezeichnet wiederum eine ideologische Haltung, nämlich die Haltung, dass die Bürokratie der Gesellschaft übergeordnet ist und diese kommandiert, dass die breite Masse der Bevölkerung sich der Bürokratie unterwerfen müsse, ihr passiv zu folgen habe. Diese ideologische Haltung ist ein gesetzmäßiges Beiprodukt des Staates und der Klassengesellschaft und legitimiert die Existenz der staatlichen Bürokratie gegenüber der Bevölkerung.
***
Aus der Existenz des Bürokratismus als einer notwendigen Erscheinung in der Klassengesellschaft entsteht die ständige Gefahr, dass revolutionäre und kommunistische Organisationen ebenfalls in bürokratische Tendenzen verfallen, dass Kader:innen zu Parteibeamt:innen degenerieren, dass die revolutionäre Arbeit in Routinen erstarrt und jegliche Dynamik einbüßt und dass kommunistische Organisationen am Ende die lebendige Verbindung zu den Massen verlieren. Wir stellen im folgenden Artikel die historischen Wurzeln des Bürokratismus in den Klassengesellschaften dar. Nach einem kurzen Blick auf bürokratische Entwicklungen in der Sowjetunion und der historischen KPD wenden wir uns den Gefahren des Bürokratismus für die heutige politische Arbeit zu und diskutieren konkrete Beispiele.
Klassengesellschaft, Staat und Bürokratie
Der Bürokratismus als politisch-soziale und ideologische Erscheinung ist historisch mit der Bürokratie als ein notwendiger Bestandteil der Klassengesellschaften und des Staates verbunden. Tatsächlich erfolgte schon die Entwicklung der Klassengesellschaft aus der Urgesellschaft nicht nur durch die Einführung fremder Arbeitskräfte und ihre Verwandlung in Sklav:innen, sondern auch durch die Verselbständigung einer führenden gesellschaftlichen Schicht (z.B. Stammesführer, Priester, Krieger) und die Aneignung des gesellschaftlichen Mehrproduktes durch diese Schicht.
Engels hat diese historischen Vorgänge im „Anti-Dühring“ beschrieben: „In jedem Gemeinwesen bestehn von Anfang an gewisse gemeinsame Interessen, deren Wahrung einzelnen, wenn auch unter Aufsicht der Gesamtheit, übertragen werden muß: Entscheidung von Streitigkeiten; Repression von Übergriffen einzelner über ihre Berechtigung hinaus; Aufsicht über Gewässer, besonders in heißen Ländern; endlich, bei der Waldursprünglichkeit der Zustände, religiöse Funktionen. Dergleichen Beamtungen finden sich in den urwüchsigen Gemeinwesen zu jeder Zeit (…). Sie sind selbstredend mit einer gewissen Machtvollkommenheit ausgerüstet und die Anfänge der Staatsgewalt. Allmählich steigern sich die Produktivkräfte; die dichtere Bevölkerung schafft hier gemeinsame, dort widerstreitende Interessen zwischen den einzelnen Gemeinwesen, deren Gruppierung zu größern Ganzen wiederum eine neue Arbeitsteilung, die Schaffung von Organen zur Wahrung der gemeinsamen, zur Abwehr der widerstreitenden Interessen hervorruft. Diese Organe, die schon als Vertreter der gemeinsamen Interessen der ganzen Gruppe, jedem einzelnen Gemeinwesen gegenüber eine besondre, unter Umständen sogar gegensätzliche Stellung haben, verselbständigen sich bald noch mehr, teils durch die, in einer Welt, wo alles naturwüchsig hergeht, fast selbstverständlich eintretende Erblichkeit der Amtsführung, teils durch ihre, mit der Vermehrung der Konflikte mit andern Gruppen wachsende Unentbehrlichkeit.“ Diese Verselbständigung der gesellschaftlichen Funktion gegenüber der Gesellschaft steigerte sich mit der Zeit „bis zur Herrschaft über die Gesellschaft“ und ließ die ursprünglichen Diener der Gesellschaft zu Herren über sie werden, etwa in Gestalt „als orientalischer Despot oder Satrap, als griechischer Stammesfürst“ oder „als keltischer Clanchef“2.
Der qualitative Sprung von einer Schicht mit bestimmten (z. B. leitenden) Funktionen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zur herrschenden Klasse findet in dem Moment statt, in dem diese Schicht dauerhaft die alleinige Verfügungsgewalt über einen wesentlichen Teil der gesellschaftlichen Produktionsmittel erlangt und sich auf dieser Grundlage das Mehrprodukt aneignet, das von den anderen, ausgebeuteten Klassen erzeugt wird. Mit der Herausbildung der Klassengesellschaft entsteht auch der Staat als „das Produkt und die Äußerung der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze“3, der sich als besondere Gewalt gegenüber der Gesellschaft organisiert und, mit der Ausdifferenzierung seiner Funktionen, eine immer größere Schicht von Beamt:innen schafft, die als Anhängsel der herrschenden Klasse fungiert und die Gewalt des Staates gegenüber der Gesellschaft ausübt (etwa als Polizei, Gerichte, Verwaltung, usw.).
Diese Bürokratie bildet zu allen Zeiten einen festen Bestandteil des Staates in der Klassengesellschaft und hat sich mit der Entstehung des Kapitalismus und der zentralisierten Nationalstaaten4 sowie später mit dem Übergang des Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium weiterentwickelt. Im Imperialismus finden wir die Bürokratie schließlich nicht mehr nur im Staatsapparat, sondern in allen gesellschaftlichen Großorganisationen wie Konzernen, politischen Parteien und Bewegungen sowie Gewerkschaften – und damit auch den Bürokratismus als das damit verbundene charakteristische Denken und Handeln. Die Bürokratie und der Bürokratismus entwickeln sich im Zusammenhang mit dem Funktionieren großer arbeitsteiliger Organisationen. Bürokratie entsteht immer dort, wo verallgemeinerte Herangehensweisen für konkrete Probleme gefunden werden müssen (man denke etwa an die typische Verwaltungsbehörde). In einem gewissen Maße ist ein solches verallgemeinertes Herangehen auch in jeder Gesellschaft notwendig – jedoch nimmt es in Klassengesellschaften aufgrund seiner Wurzel in den Herrschaftsverhältnissen in Form von Bürokratismus ein Eigenleben an und dient der Verewigung der privilegierten Stellung des Beamtenapparates.
In Deutschland waren die Bürokratie und der Bürokratismus als besondere Merkmale des preußischen Staates immer besonders ausgeprägt. Der ungarische Kommunist und marxistische Ökonom Eugen Varga beschrieb dies in einem Text über die Besonderheiten des deutschen Imperialismus: „Zum Preußentum gehört weiter die Idealisierung des Obrigkeitsstaates. Dem preußischen Staat war jede Demokratie fremd, er war immer ein Obrigkeitsstaat, der von dem preußischen Adel, den Junkern verwaltet wurde, von denselben Leuten, die aus ihren Kreisen auch das Offizierskorps des Heeres stellten. Nirgends war die Staatsbürokratie eine solche Macht wie in Preußen, nirgendwo war das ganze Leben der ‚Untertanen‘: Wirtschaft, Schule, Literatur, Kunst und Wissenschaft so tiefgehend und allumfassend reglementiert wie in Preußen.“5 Mit der gewaltsamen Vereinigung der deutschen Staaten unter preußischer Führung im Jahr 1871 drückte der preußische Absolutismus diese Staatspraxis und das damit verbundene Staatsverständnis dem gesamten Deutschen Reich auf – und hat damit den notorisch bürokratischen deutschen Staatsapparat sowie das obrigkeitsstaatliche, untertänige Denken in der deutschen Bevölkerung bis heute nachhaltig geprägt: „In Deutschland ist alles verboten, was nicht erlaubt ist“ – also ausdrücklich von einer Obrigkeit genehmigt wurde – Dieses geflügelte Wort beschreibt bis heute das typische Denken und Handeln des braven deutschen Bürgers, ob beim Umgang mit Behörden oder im Kleingartenverein. Doch auch die politische Widerstandsbewegung und die Kommunist:innen in Deutschland sind vielfach von diesem Denken geprägt. Notwendig ist daher, dass wir mit der preußischen Mentalität, mit dem Untertanengeist in uns brechen, aber auch mit der preußischen Kontroll- und Reglementierungswut.
Bürokratismus in der kommunistischen Bewegung und den sozialistischen Staaten
Bürokratismus beim Aufbau des Sozialismus
Bürokratie und Bürokratismus werden als politisch-gesellschaftliche Erscheinungen nach der sozialistischen Revolution nicht einfach verschwinden. Zwar ist die Aussage, dass der Staat mit der Weiterentwicklung des Sozialismus und dem Übergang zum Kommunismus allmählich abstirbt, allgemein richtig6. Dieses „Absterben“ ist jedoch, wie die ersten Anläufe zur Errichtung sozialistischer Gesellschaften in der Sowjetunion und anderen Ländern gezeigt haben, keineswegs ein spontaner Prozess, den die Arbeiter:innenklasse und die Kommunist:innen nur abwarten müssten, ohne konkret und unablässig etwas dafür zu tun.
Vielmehr ist der sozialistische Staat von Anfang an von einem Widerspruch geprägt: Einerseits muss die Arbeiter:innenklasse die Staatsmacht als Diktatur des Proletariats übernehmen und ausüben, nämlich um die gestürzte Kapitalist:innenklasse niederzuhalten, sozialistische Produktionsverhältnisse zu errichten und immer mehr Arbeiter:innen in die Ausübung gesellschaftlicher Funktionen einzubeziehen. Andererseits aber muss sie diese Staatsmacht gerade durch die Einbeziehung der Massen zu einer „Assoziation der Werktätigen“ weiterentwickeln und damit aktiv überflüssig machen.
Dieser Widerspruch kennzeichnet auf der allgemeinen Ebene auch jede revolutionäre Organisation vor und nach der Revolution: Ihr Ziel ist es, die Klassengesellschaft und damit alle Macht- und Unterdrückungsverhältnisse zu stürzen. Zugleich ist es dafür unumgänglich, dass sie selbst die Macht übernimmt, dazu eine straffe Organisation der Revolutionär:innen schafft und in ihren Reihen gewisse „Machtverhältnisse“ wie z. B. die Unterordnung unterer Ebenen unter höhere Leitungsebenen verankert – auch wenn diese Machtverhältnisse im Rahmen des demokratischen Zentralismus rein funktional sind, keinen Selbstzweck bilden und sich damit fundamental von den Machtverhältnissen in Klassengesellschaften unterscheiden. Solche Strukturen aufzubauen ist aber allein schon notwendig, um gegenüber dem Klassenfeind schlagkräftig zu sein. Trotzdem besteht prinzipiell immer die Gefahr, dass revolutionäre Organisationen Menschen aus der bürgerlichen Gesellschaft anziehen, die – wenn auch unbewusst – gerade das Ausüben von Macht über andere reizt. Mehr noch: Aufgrund unserer bürgerlich-patriarchalen Erziehung trägt jede:r von uns solche Tendenzen in mehr oder weniger ausgeprägtem Maße in sich. Dass diese sich in der politischen Arbeit geltend machen, lässt sich niemals vollständig verhindern, muss aber im Rahmen der Entwicklung der Persönlichkeiten von Revolutionär:innen fortwährend untersucht und zurückgedrängt werden. Eine Kritik aus dem anarchistischen Lager an Kommunist:innen, die gerade den Aufbau von zentralistischen Organisationen mit Leitungsstrukturen und das Ziel der Diktatur des Proletariats verteufelt und als Gegenmodell die Abschaffung zentraler Leitungsstrukturen fordert, übersieht, dass man das Problem der Macht- und Unterordnungsverhältnisse nicht dadurch löst, indem man einfach alle Machtverhältnisse für aufgehoben erklärt. Das ist in der bürgerlichen Gesellschaft, in der alle Menschen mit Macht- und Unterordnungsverhältnissen sozialisiert sind und diese tief in ihren Persönlichkeiten verinnerlicht haben, eine Illusion: Und so bilden sich auch in jeder autonomen politischen Struktur, die sich für frei von Macht und Führung erklärt, wieder soziale Hierarchien heraus – nur, dass diese völlig informell sind und gerade nicht durch eine organisatorische Struktur kontrolliert und eingehegt werden.
Der wirkliche Weg zur Aufhebung aller Macht- und Unterdrückungsverhältnisse zwischen den Menschen erfordert dagegen – und das ist der schwierige dialektische Widerspruch, den es in der Praxis zu lösen gilt – gerade die Nutzung von organisatorischer und staatlicher Macht. Dieser Widerspruch bedeutet aber für den Sozialismus, dass die proletarische Staatsmacht gerade für die Erfüllung der ersten beiden Aufgaben – die Niederhaltung der alten Ausbeuter:innenklassen und den Aufbau sozialistischer Produktionsverhältnisse – noch für unbestimmte Zeit auf einen Staatsapparat und eine Bürokratie für zahlreiche spezialisierte Funktionen – von den wirtschaftlichen Planungsbehörden bis zu Militär und Geheimdiensten – zurückgreifen muss.
In Russland nach 1917 ging das so weit, dass die Bolschewiki einen Teil des alten zaristischen Beamtenapparates zunächst weiter beschäftigen mussten, um das reibungslose Funktionieren des Staates gewährleisten zu können. Diese Beamten standen der Sowjetmacht aber zu einem großen Teil feindselig gegenüber und taten ihren Dienst nur, weil ihnen der sozialistische Staat z. B. die gewohnten hohen Gehälter aus der Zarenzeit weiter bezahlte. Solche Maßnahmen waren unumgänglich, solange die Masse der Arbeiter:innen und Bäuer:innen noch nicht unmittelbar in die Verwaltungsaufgaben einbezogen werden konnte (z. B. weil ein hoher Prozentsatz von ihnen noch Analphabet:innen waren). Lenin und Stalin sind in ihren Texten nach der Oktoberrevolution immer wieder auf dieses Problem eingegangen und haben dabei eingeräumt, dass die Bolschewiki das Problem des Bürokratismus vor der Revolution noch unterschätzt hatten. Stalin etwa schrieb im Dezember 1923: „Im Jahre 1917 (…) stellten wir uns die Sache so vor, dass wir die Kommune haben würden, dass dies eine Assoziation der Werktätigen sein werde, dass wir dem Bürokratismus in den Behörden ein Ende setzen würden und dass es uns gelingen werde, den Staat, wenn nicht in allernächster Zeit, so doch nach zwei, drei kurzen Perioden zu einer Assoziation der Werktätigen zu machen. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass wir von diesem Ideal noch weit entfernt sind (…)“7
Damit einher geht aber auch die ständige Gefahr, dass sich diese Apparate verselbständigen, dass sich bürokratisches Denken und Handeln in Partei, Staat und Massenorganisationen breit machen und die Grundlagen des Sozialismus unterhöhlen, dass ähnlich wie bei der historischen Entstehung der Klassengesellschaften auch im Sozialismus eine neue herrschende Klasse durch die Verselbständigung gesellschaftlicher Funktionsträger:innen entsteht: Genau so ist es in der Sowjetunion und anderen sozialistischen Staaten ab den 1950er Jahren schließlich passiert8. Der Sozialismus ist eine Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Kommunismus, und solange die klassenlose Gesellschaft noch nicht erreicht ist, ist die Neuentstehung von Klassenunterschieden aus dem Schoß der noch bestehenden gesellschaftlichen Widersprüche im Sozialismus immer eine Möglichkeit.
Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Frage des Patriarchats und der Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu legen, denn die sozialistische Revolution kann nur im Zusammenhang mit dem Kampf um die Beseitigung des Patriarchats voranschreiten. Hierbei geht es nicht nur um die Beseitigung der offensichtlichsten Formen der Unterdrückung von Frauen, ihre vollständige Einbeziehung in die Berufstätigkeit und die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit. Vielmehr geht es auch um die Beseitigung der verinnerlichten Macht- und Unterdrückungsverhältnisse in den Persönlichkeiten aller Gesellschaftsmitglieder durch das Patriarchat: In den bürgerlichen Familienstrukturen, die auch im Sozialismus nicht über Nacht verschwunden sein werden, findet die Erziehung von Kindern nämlich auf der Basis von Gewalt und persönlicher Abhängigkeit statt. In der bürgerlichen Gesellschaft verbindet sich diese frühe Verinnerlichung von Macht und Unterordnung in der kindlichen Persönlichkeit mit der Verinnerlichung sozialer Hierarchien auf der Grundlage des Widerspruchs zwischen leitenden und ausführenden Tätigkeiten in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung9. Beides wird im Sozialismus nicht mit einem Schlag aufgehoben werden, sondern muss kontinuierlich bekämpft und immer weiter zurückgedrängt werden. Dafür muss dort eine Vielzahl von Maßnahmen zur Revolutionierung der Gesellschaft und der Persönlichkeiten der Individuen ergriffen werden. Diese Aufgabe wird mehrere Generationen in Anspruch nehmen, und die absolut notwendige Bedingung für ihre Lösung ist die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit und Erziehung als Voraussetzung für die Überwindung der Kleinfamilie als „Keimzelle“ der bürgerlichen Gesellschaft. Auf diese Weise ist der Kampf gegen die Bürokratie eng mit dem Kampf gegen das Patriarchat verbunden.
Die Gefahr einer Verselbständigung der Bürokratie besteht keineswegs nur in einem Fall wie im frühen Sowjetrussland, als der alte zaristische Beamtenstand in Teilen und für einige Zeit weiter die Verwaltung des sozialistischen Staates leitete und dafür materielle Privilegien erhielt. Denn auch, als diese Funktionen in der Sowjetunion ab den 1920er Jahren nach und nach von Kommunist:innen übernommen wurden, die (zunächst noch) keine hohen Gehälter für ihre Arbeit im Staatsapparat bekamen, zeigten sich zahlreiche bürokratische Tendenzen im sozialistischen Staat und der Kommunistischen Partei. Für die Entstehung solcher Tendenzen reicht es nämlich schon aus, dass überhaupt noch eine Trennung zwischen leitenden und ausführenden Tätigkeiten in der sozialistischen Gesellschaft fortbesteht, dass leitende Funktionen mit einem höheren sozialen Prestige verbunden sind und dass Parteifunktionär:innen und Staatsbedienstete unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbedingungen haben als große Teile der Arbeiter:innenklasse – auch wenn sie ursprünglich selbst aus dieser stammen. Deshalb müssen kommunistische Parteien einen ständigen Kampf gegen den Bürokratismus in ihren Reihen führen, ist dieser Kampf lebensentscheidend für die sozialistische Gesellschaft.
Zu den Erscheinungen des Bürokratismus, über die in der Sowjetunion in den 1930er Jahren berichtet wurde, gehörten z. B. Abgehobenheit, Amtsmissbrauch, Dekretierwut, Korruption, Vetternwirtschaft, verschwenderischer Umgang mit gesellschaftlichem Eigentum u. v. m. Stalin kämpfte zeitlebens entschieden gegen diese bürokratischen Tendenzen in Partei und Staat, schimpfte z. B. in einem Referat vor dem Zentralkomitee 1926 über die Verschwendung hunderttausender Rubel für Feierlichkeiten und Festversammlungen („Bacchanalien“) durch rote Bürokraten und stellte ernüchtert fest, „dass Parteilose, wie man beobachten kann, mit den Mitteln unseres Staates bisweilen sorgsamer umgehen als Parteimitglieder“10. Zwei Jahre später warnte er auf dem VIII. Kongress des Kommunistischen Jugendverbandes noch einmal ausdrücklich vor den „neuen Bürokraten“: „Der kommunistische Bürokrat ist der gefährlichste Typ des Bürokraten. Warum? Weil er seinen Bürokratismus mit seiner Parteimitgliedschaft maskiert. Und solche kommunistischen Bürokraten gibt es bei uns leider nicht wenig.“11 Die Reden und Briefwechsel Stalins mit anderen Kommunist:innen sind insgesamt voll von Beispielen seines ständigen Kampfes gegen den roten Bürokratismus12.
Aus den bisherigen Anläufen zur Errichtung der Diktatur des Proletariats können wir verschiedene Schlussfolgerungen ziehen, welche die Entstehung einer abgehobenen bürokratischen Schicht verhindern und die Einbeziehung der breiten Masse der Arbeiter:innenklasse in staatliche Aufgaben befördern können. Die Pariser Kommune etwa führte während ihres Bestehens 1871 die Wählbarkeit, Rechenschaftspflicht und jederzeitige Absetzbarkeit aller staatlichen Funktionär:innen einschließlich der Beamt:innen und Richter:innen ein und ersetzte das stehende Heer durch das bewaffnete Volk. Jegliche materiellen Privilegien wurden gestrichen. In der Sowjetunion galt für Kommunist:innen das „Parteimaximum“, das heißt die Pflicht, den Teil ihres staatlichen Gehaltes, der eine gewisse Grenze überschreitet, abzugeben: Dies sollte verhindern, dass Parteimitglieder sich durch ihre Funktionen im Staat und den sozialistischen Betrieben auf Kosten der Gesellschaft bereichern konnten und damit Karrierist:innen aus den Reihen der Partei fernhalten. Das Parteimaximum wurde jedoch in den 1930er Jahren wieder abgeschafft13. Ebenso wurden zahlreiche Maßnahmen zur Einbeziehung parteiloser Arbeiter:innen in staatliche Aufgaben und die Kontrolle von Partei- und Staatsorganen getroffen. Hierzu zählte etwa die Arbeiter- und Bauerninspektion (Zentrale Kontrollkommission), die sich auf allen Parteiebenen von Zentralkomitee bis zu lokalen Organisationseinheiten unabhängig von der Parteiführung organisierte und jede:r Sowjetbürger:in die Möglichkeit gab, sich über Missstände in allen gesellschaftlichen Bereichen zu beschweren. 1936 wurde die Kontrollkommission in ihrer unabhängigen Form jedoch wieder aufgelöst und der Parteiführung untergeordnet. Als deren Anhängsel konnte sie ihre kontrollierende Funktion nur noch eingeschränkt wahrnehmen und damit auch dem wuchernden Bürokratismus in Staat und Partei nicht mehr konsequent entgegentreten. Ohne diese institutionalisierte Kontrolle von unten hing der Kampf gegen den Bürokratismus faktisch nur noch am Einsatz einzelner Personen wie Stalin – und nach dessen Tod im März 1953 hatten die Bürokrat:innen in der KPdSU mehr oder weniger freie Bahn. Denn es kam hinzu, dass gerade viele der fortschrittlichsten und entschlossensten Kommunist:innen im Großen Vaterländischen Krieg zwischen 1941 und 1945 im Kampf gegen den Faschismus starben und andere ihre Plätze und „Posten“ einnahmen.
Bei der Bekämpfung des Bürokratismus gibt es jedoch nicht die eine Maßnahme, die das Problem ein für alle mal löst. Vielmehr ist die entscheidende Frage für das Verhindern bürokratischer Tendenzen die aktive, ständige Einbeziehung der Massen in die Leitung des Staates. Das wichtigste Instrument hierfür waren in der Sowjetunion die Sowjets (Räte), deren selbständige Aktivität aber ab spätestens Ende der 1920er Jahre erheblich nachließ. Eine detaillierte Einschätzung, warum dies so geschehen ist, würde den Rahmen dieses Textes sprengen. Als These lässt sich hierzu jedoch formulieren, dass ein hohes politisches Aktivitätsniveau einer breiten Masse der Bevölkerung grundsätzlich kein Selbstläufer ist, sondern einem gewissen „Trägheitsgesetz“ folgt. Das heißt, als die allerwichtigsten Kämpfe der Revolution nach dem Bürgerkrieg in Sowjetrussland zugunsten des Proletariats entschieden waren und die Gesellschaft eine gewisse Stabilität erreicht hatte, mag für viele auch der Ansporn weggefallen sein, sich selbst noch besonders aktiv in den gesellschaftlichen Organen einzusetzen. Der Staat funktionierte ja. In der Sowjetunion kamen außerdem noch die rückschrittlichen gesellschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Oktoberrevolution hinzu. Ein großer Teil der bäuerlichen Bevölkerung hatte nicht einmal 70 Jahre zuvor noch in Leibeigenschaft gelebt, und ein großer Teil dieser Bäuer:innenschaft ging mit der Industrialisierung in die Städte und verwandelte sich in Arbeiter:innen. Dies sind nur einige wichtige Erkenntnisse auch für die Zukunft. Wie die Lebendigkeit und Initiative der proletarischen Massen in den Räten und anderen Organen der Diktatur des Proletariats dauerhaft aufrecht erhalten werden kann, muss in zukünftigen Anläufen zur Errichtung des Sozialismus in der Praxis entwickelt werden.
Bürokratische Tendenzen in der KPD
Die Frage des Bürokratismus und seiner Bekämpfung stellt sich für Kommunist:innen nicht erst nach der sozialistischen Revolution, sondern schon lange vorher beim Aufbau der Kommunistischen Partei und allen anderen Teilen der kommunistischen Bewegung. Wir haben oben gesehen, dass es ein kennzeichnendes Merkmal des Imperialismus ist, dass der Bürokratismus nicht nur im Staat Einzug hält, sondern in allen großen Institutionen wie z. B. Firmen, politischen Parteien und Gewerkschaften. Auch in kommunistischen Parteien gibt es immer wieder spontane Tendenzen zum Bürokratismus. Dies gilt gerade in den imperialistischen Ländern, in denen die kommunistischen Organisationen häufig noch besonders stark von bürgerlichen und sozialdemokratischen Traditionen geprägt sind.
Dies betraf historisch auch die 1918/19 gegründete KPD, die zunächst als Abspaltung der SPD bzw. USPD sowie als Sammelbecken verschiedenster linker Strömungen entstand. Bei ihrer Gründung hatte die KPD noch kein klares theoretisches Konzept über die Art von Partei, die es für die Organisierung der Revolution in Deutschland braucht – geschweige denn, dass sie nach einem solchen Konzept gearbeitet hätte. Während der gesamten 1920er Jahre war deshalb die Umstellung der KPD auf Organisationsformen, die dem Konzept einer Partei leninistischen Typs entsprachen, die sogenannte „Bolschewisierung“, eine entscheidende Aufgabe für die Parteiführung und die Kommunistische Internationale (Komintern).
Zu den sozialdemokratischen Traditionen in der Arbeit der KPD, die man zum Teil auch als Tendenzen des Bürokratismus bezeichnen kann, gehörten z. B. eine sehr schematische Trennung zwischen bezahlten Parteifunktionär:innen, die einen Großteil der Parteiarbeit quasi als Lohnarbeit verrichteten und der Masse der Parteimitglieder, die häufig eher passiv waren und nicht als aktive Parteikader:innen arbeiteten. Eine Bestandsaufnahme der Komintern von 1932 kommt diesbezüglich etwa zu dem Schluss, dass die Unterbezirke der KPD vielfach keine Initiative zeigten bzw. diese unterdrückt werde, dass sie stattdessen „alles von der Zentrale erhalten“ sollten14.
Ebenso zählen zu den sozialdemokratischen Traditionen in der kommunistischen Bewegung die Unterordnung der Parteiarbeit unter die parlamentarische Arbeit sowie eine schematische Trennung zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen, vor allem zwischen Partei- und Gewerkschaftsarbeit. Auch diese spontanen Tendenzen zu erkennen und zu jedem Zeitpunkt aktiv zu bekämpfen, ist ein wichtiges Element des Kampfes gegen die Bürokratisierung kommunistischer Parteien, gegen die Tendenz, dass in diesen Parteien nur bürokratische Apparate das Sagen haben, während die Parteibasis lediglich Befehlen folgt.
Die Gefahr des Bürokratismus in der heutigen politischen Praxis
In dem kommenden Abschnitt wollen wir uns nun mit den Gefahren des Bürokratismus beschäftigen, die schon heute in unserer konkreten praktischen Arbeit entstehen können und denen wir mit einer besonderen Aufmerksamkeit und Wachsamkeit begegnen müssen.
Wir haben also gesehen, dass der Bürokratismus
- eine gesetzmäßige Erscheinung der Klassengesellschaft ist, die in der bürgerlichen Gesellschaft eine besondere Qualität annimmt und daher auch im Sozialismus als Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Kommunismus noch lange weiter existieren muss,
- dass er die ständige Gefahr der Neuentstehung von Klassenwidersprüchen im Sozialismus hervorbringt und die Kommunist:innen daher einen ständigen Kampf gegen ihn, gerade auch in ihren eigenen Reihen führen müssen,
- dass der Kampf der Kommunist:innen gegen den Bürokratismus in den eigenen Reihen nicht erst im Sozialismus beginnt, sondern schon im Kapitalismus unablässig geführt werden muss, und
- dass die Frage des Bürokratismus eng mit der Frage der Verinnerlichung von Macht- und Unterordnungsverhältnissen in der bürgerlich-patriarchalen Gesellschaft zusammenhängt: Diese wurzelt sowohl in der patriarchalen Kleinfamilie und der Erziehung von Kindern mittels Gewalt und persönlicher Abhängigkeit als auch in der Verinnerlichung sozialer Hierarchien, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft auf der Grundlage der Trennung von leitenden und ausführenden Tätigkeiten entwickeln und ausdifferenzieren.
Wir leben heute in der kapitalistischen Klassengesellschaft und sind der bürgerlichen Ideologie und Theorie und Praxis ununterbrochen ausgesetzt. Hieraus ergibt sich, dass das bürgerliche Denken und Handeln auch immer wieder Einzug in unsere Praxis findet. Der Bürokratismus stellt eine besondere Seite dieses Problems dar und hemmt unsere Entwicklung zu revolutionären Kollektiven sowie zu selbständig denkenden und handelnden revolutionären Persönlichkeiten, die willens und in der Lage sind, den bestehenden Ist-Zustand der Bewegung in Theorie und Praxis ständig zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und zu revolutionieren.
Der Bürokratismus tritt in den verschiedensten Ausprägungen in Erscheinung und überschneidet sich mit anderen Ausprägungen der bürgerlichen Ideologie wie z. B. dem Liberalismus. Er ist jedoch nicht nur eine Frage des Bewusstseins, sondern basiert, wie wir gesehen haben, auf objektiven Quellen. Da sind vor allem erst einmal die „sachlichen“ Quellen, das heißt die praktischen Notwendigkeiten der politischen Arbeit. Ein gewisses Maß an Bürokratie ist in jeder Organisation, also auch der kommunistischen, erforderlich, um überhaupt leiten zu können. Jede Organisation muss allgemeine Schlussfolgerungen aus ihrer Arbeit ziehen und demgemäß ihre Arbeit strukturieren und führen. Das schließt auch ein, dass von der Führung bis zur Basis Entscheidungen nach bestimmten Regeln und Verfahren getroffen werden müssen. Diese Regeln und Verfahren schließen z. B. das Erstellen von Tagesordnungen, Protokollen, Berichtswesen usw. ein und helfen vielen Genoss:innen überhaupt erst einmal dabei, ihre Arbeit aufzunehmen und strukturiert durchzuführen. In der richtigen Dosierung geben diese Regeln und Verfahren also Sicherheit und können die Arbeit voranbringen. Problematisch wird es dann, wenn die Verfahren schleichend wichtiger werden als die Inhalte der Arbeit und sich Tendenzen in der Organisation herausbilden, sich daran festzuklammern. Diese Tendenz gehört in wohl jeder bürgerlichen Organisation zum Alltag und droht sich auch in kommunistischen Organisationen einzuschleichen, wenn sie nicht immer wieder hartnäckig bekämpft wird..
Neben diesen „sachlichen Quellen“ bilden jedoch auch der Widerspruch zwischen leitenden und ausführenden Tätigkeiten in der Klassengesellschaft und die damit verbundenen sozialen Hierarchien eine objektive Quelle des Bürokratismus. Hierbei geht es nicht nur um formale Hierarchien wie z. B. die notwendige Entscheidungsgewalt von Parteikollektiven und führenden Organen, auch wenn dort ebenfalls problematische Tendenzen entstehen können, z. B. wenn „Wissenshierarchien“ ausgenutzt werden. Vielmehr geht es auch um ungesunde Tendenzen in der Art und Weise, wie diese Leitungstätigkeiten – wie z. B. die Anleitung von Massenorganisationen und deren Mitgliedern – mit Leben gefüllt werden. Die Entstehung von bürokratischer Abgehobenheit ist prinzipiell immer eine Gefahr für die politische Arbeit, da auch Kommunist:innen als bürgerliche Persönlichkeiten in der Klassengesellschaft sozialisiert sind und daher z. B. von Konkurrenzdenken, Bequemlichkeit und anderen bürgerlichen Eigenschaften nicht frei sind. Schon allein die Tatsache, dass Kommunist:innen in der bürgerlichen Gesellschaft, umgeben und beeinflusst von ihr, revolutionäre Arbeit verrichten, kann zu bürokratischen Tendenzen führen oder diese verstärken. Es ist in der Geschichte der kommunistischen Bewegung schon vorgekommen, dass sich auch in kleinen Organisationen und deren Umfeld informelle soziale Hierarchien gebildet und verselbständigt haben – bis hin dazu, dass faktisch kleine Machtzirkel in ihren Reihen entstanden sind. Diese Gefahr kann z. B. dadurch vergrößert werden, wenn sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kommunist:innen so stark unterscheiden, dass einzelne von ihnen gar keine Berührungspunkte mehr mit Teilen der Lebensrealität der Arbeiter:innenklasse haben, z. B. wenn sie in strengster Illegalität arbeiten. Ebenso kann die Unerfahrenheit und Überforderung von anleitenden Genoss:innen Bürokratismus befördern, etwa durch die Flucht in eine Flut von Schemata und Konzeptpapieren.
All diese objektiven Quellen des Bürokratismus müssen wir uns bewusst machen, gerade um geeignete Gegenmaßnahmen gegen bürokratische Tendenzen entwickeln und diese zurückdrängen zu können.
Worin besteht aber die Gefahr des Bürokratismus in der revolutionären und kommunistischen Bewegung hier und heute, ganz konkret?
Die Gefahr des bürokratischen Denkens und Handelns äußert sich heute unter anderem darin, wenn Organisationen ihre Lebendigkeit und Dynamik verlieren und zu formalen Gremien erstarren, in denen allein die Funktionär:innen als „Beamt:innen“ über alles entscheiden und diktieren und die Masse der Mitglieder ihnen und den Apparaten rein passiv folgt.
Dieses Phänomen kann immer in zwei Richtungen auftreten: Einmal von oben, wenn führende Organe oder Personen in leitenden Funktionen ein solches Denken ausprägen, einseitig Unterordnung verlangen, mit Kritiken nicht umgehen können oder bei jeder kleinen Initiative von der Basis Angst vor Kontrollverlust entwickeln und diese abwürgen. Oder wenn die Anleitung mit einer fehlenden Vorbildfunktion verbunden ist, sich anleitende Genoss:innen nur auf die „Autorität des Amtes“ stützen und explizit darauf berufen, anstatt selbst als aktivste Genoss:in voranzugehen.
Aber es kann sich gerade auch von unten entwickeln, wenn die Basis passiv oder sogar unterwürfig und autoritätsfürchtig ist, bei jeder Kleinigkeit fragt „Dürfen wir das überhaupt?“ und ohne konkrete Direktiven faktisch handlungsunfähig oder -unwillig ist. Häufig bestärken sich Tendenzen von oben und unten gegenseitig.
Nehmen wir einige Beispiele hierfür: Eine spontane Bewegung hat sich im Land entwickelt und wir verhalten uns in der Stadt XY nicht dazu, weil wir erst einmal abwarten, ob es „von oben“ eine Ausrichtung dazu gibt. Oder: Eine Genossin, die die Tagesordnung für ein Treffen vorbereiten sollte, ist nicht da und wir sind deshalb unfähig, unser Treffen ordentlich abzuhalten. Oder: Ich zeige keine Initiative zu einer bestimmten Frage, weil es noch keine konkreten Aufgabenstellungen von den leitenden Organen hierfür gibt und ich Angst habe, einen Fehler und damit einen schlechten Eindruck nach oben zu machen. Der Geist der Passivität und Unterwürfigkeit, der mangelnden Initiative von unten und des Wartens auf Anweisungen, der in diesen Beispielen zum Ausdruck kommt, fördert bürokratisches Denken und Handeln. Das müssen wir schon in den ersten Ansätzen bekämpfen. Denn es ist offensichtlich, dass eine Organisation, die einen solchen Arbeitsstil entwickelt, nicht in der Lage sein wird, weiter handlungsfähig zu sein, wenn z. B. Repressionsschläge des Klassenfeindes dazu führen, dass die Verbindungen zwischen verschiedenen Organen zeitweise abreißen.
Dasselbe gilt für bürokratische Arbeitsweisen in der Aufgabenkontrolle, etwa wenn die Erfüllung von Aufgaben nur noch formal (oder sogar gar nicht) abgefragt und abgehakt wird, anstatt eine echte Kontrolle zur Verbesserung der Arbeit zu etablieren, die dem Kollektiv und den Individuen hilft ihre Arbeit bestmöglich durchzuführen und sich dabei zu entwickeln. Ebenso kann sich der Bürokratismus in unserer Arbeit darin äußern, dass wir bestehende Strukturen wie zum Beispiel die Gremien, (Massen)organisationen und Bündnisse sowie die damit verbundenen Aufgabenverteilungen und Regeltermine in einer Stadt oder einem Gebiet als naturgegeben hinnehmen, dass wir sie nicht mehr infrage stellen. Das kann so weit gehen, dass wir nicht mehr auf spontane Entwicklungen reagieren, weil wir uns nur noch mit der Verwaltung der von uns selbst geschaffenen Organisationen beschäftigten und uns, anstatt diese anzuleiten, von diesen leiten lassen.
Bürokratismus kann sich auch dann in unsere politische Arbeit einschleichen, wenn wir keinen Parteistandpunkt einnehmen, das heißt wenn wir unsere Verantwortung für die Gesamtbewegung vernachlässigen, bei der Arbeit nur auf unseren eigenen, engen Aufgabenbereich und ansonsten nicht nach rechts und nicht nach links gucken, wenn wir kein echtes, aktives Interesse für die Arbeitsbereiche anderer Genoss:innen zeigen. Dies kann sich z. B. im Extremfall darin äußern, dass sich Missstände in einem Arbeitsbereich entwickeln, die Genoss:innen, die für diesen Bereich nicht unmittelbar zuständig sind, aber „den Elefanten im Raum“ ignorieren, die Missstände nicht ansprechen, aus eigener Bequemlichkeit nicht nachhaken, oder aber sie aus Betriebsblindheit gar nicht erst wahrnehmen. Manchmal steckt hinter diesem Herangehen der unbewusste Wunsch, wenn ich Genoss:in XY nicht in seinen/ihren Arbeitsbereich reinrede, tut sie das umgekehrt auch nicht, also ein Vorgehen nach dem Motto: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ein weiteres Symptom des Bürokratismus ist eine Tendenz zur Regulierungswut, wenn aus Kommunist:innen also quasi Prozessfetischist:innen werden, wie man sie aus allen Arten von Großorganisationen kennt. Beim Prozessfetischismus wird die Wahrung der Form bei der politischen Arbeit wichtiger als der politische Inhalt. Ein Beispiel: Morgen ist eine Streikkundgebung in der eigenen Stadt angekündigt, aber die Organisation, die sich mit betrieblichen Fragen beschäftigt, hat ihr Treffen erst in einer Woche, und wartet erst einmal die ordnungsgemäße Diskussion ab, bevor sie in Aktion tritt. Oder aber die berühmte Planungswut: Die Nachbarschaftsarbeit in meiner Stadt wird erst monatelang endlos geplant und alle möglichen Probleme im Vorfeld aufgemacht, bevor auch nur ein einziger praktischer Schritt unternommen worden ist, sie in Gang zu bringen.
Eine Form des Prozessfetischismus ist es auch, immer neue Gremien, Zwischengremien und Organisationsstrukturen zu schaffen, die immer mehr Berichte, Protokolle, Vorbereitungen und Diskussionen hervorbringen, die wiederum von anderen gelesen und nachvollzogen werden müssen, aus denen sich aber kein Mehrwert für die Arbeit ergibt, während sie gleichzeitig ständig große Mengen an Kräften binden. Ein weiteres Beispiel wäre das Organisieren von vielen Extratreffen, die nicht wirklich notwendig sind. Wenn es ganz schlecht läuft, führt ein solches Herangehen dazu, dass ständig alle Kader:innen an einem Ort mit Terminen überlastet sind, sich aber keine Ergebnisse, Erfolge und Fortschritte mehr in der Arbeit einstellen, das heißt, der Arbeitsstil wird zunehmend administrativ bei einer allgemeinen Stagnation der Entwicklung. Dies kann dann darin gipfeln, wenn nach dem Aufstellen, Einfordern und Diskutieren immer neuer bürokratischer Regeln und Prozesse in der Praxis trotzdem eher ein Chaos herrscht, weil sich niemand mehr an die mühsam bis ins kleinste Detail ausdiskutierten Beschlüsse hält.
Besonders schlimm wird der Bürokratismus, wenn die blindwütige Schaffung von Gremien und Strukturen mit Postengeschacher einhergeht, also der ständigen Fokussierung auf die Frage „Wer wird was?“, wie sie für bürgerliche Parteien und Firmen typisch ist. Hier vermischt sich der Bürokratismus mit dem bürgerlichen Karrierismus. Will ich eine bestimmte Funktion einnehmen, weil ich mich für die Aufgabe für geeignet halte – oder doch einfach weil ich selber mal was zu sagen haben will? Ist die Einnahme einer bestimmten Funktion in meinem politischen Umfeld bewusst oder unbewusst mit einem höheren sozialen Prestige verbunden, und ist es der Wunsch nach diesem Prestige, der mich motiviert? Dort, wo wir diese und ähnliche Fragen bei uns selbst und anderen nicht kritisch reflektieren, öffnen wir Bürokratismus und Postengeschacher Tür und Tor, was schnell zur Bildung von „Kasten“ selbst im Mikrokosmos verhältnismäßig kleiner Organisationen und Bewegungen führen kann. Kommt es ganz extrem, reproduzieren sich die Funktionär:innen der Organisation nur noch aus einer sehr kleinen sozialen Blase – die in der Geschichte der kommunistischen Bewegung üblicherweise übrigens männlich und intellektuell geprägt war: Die Intellektuellen wollen dann lieber unter sich bleiben, ihre Führung nicht in Frage gestellt wissen und schon gar keine Verantwortung an einfache Arbeiter, geschweige denn an Arbeiterinnen abgeben. Ein erstes, frühes Symptom für solche Tendenzen kann darin bestehen, dass neue Kräfte z. B. aus der Jugend oder Frauen systematisch zu wenig gefördert werden und ihnen keine echte Verantwortung gegeben wird, wodurch die Möglichkeiten ihrer Weiterentwicklung künstlich begrenzt wird. Bürokratismus und Intellektualismus befördern sich also häufig gegenseitig, gehen Hand in Hand miteinander.
Ideologisch stößt der Bürokratismus in der kommunistischen Bewegung häufig dann auf fruchtbaren Boden, wenn Kommunist:innen den Marxismus-Leninismus zwar oberflächlich vertreten, dieser für sie jedoch eher ein (letztlich austauschbares) identitätsstiftendes Glaubensgerüst darstellt, das sie nicht wirklich allseitig durchdringen und in die Praxis umsetzen – und von dem sie damit also in Wahrheit meilenweit abweichen. Die Hebung des ideologischen Niveaus, die Erziehung zu einem Geist der ständigen Kritik und Selbstkritik, die Etablierung eines wissenschaftlichen, analytischen Herangehens an alle Fragen des Klassenkampfes bei allen Kommunist:innen ist daher eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Bürokratismus. Jede:r Kommunist:in trägt persönlich die Verantwortung dafür, ob die Bewegung sich weiterentwickelt oder bürokratisch erstarrt, und ebenso trägt jede:r Kommunist:in persönlich die Verantwortung dafür, die Bewegung ideologisch weiterzuentwickeln. Beide Aufgaben bedingen sich gegenseitig.
Wie können wir den Bürokratismus wirksam bekämpfen?
Eine große Gefahr für bürokratische Entwicklungen entsteht aus der spontanen Tendenz bei uns allen, sich der bürgerlichen Bequemlichkeit hinzugeben, uns mit dem erreichten Stand unserer Arbeit zufrieden zu geben, ein Denken in Schubladen zu entwickeln, ideologisch oberflächlich zu sein, uns selbst und andere nicht mehr kritisch und unnachgiebig zu reflektieren, sondern uns stattdessen an vergangenen Erfolgen zu berauschen. Dies steht neben der entgegengesetzten Gefahr, dass Bürokratismus nämlich aus Unzufriedenheit und Überforderung entsteht, welche wiederum dazu führen, dass man sich an bürokratische Regeln festklammert, um nicht in einer Flut von Aufgaben unterzugehen.
Das wichtigste Element für die Bekämpfung bürokratischer Tendenzen ist die Initiative und Beharrlichkeit jedes:r einzelnen beim Kritisieren und Infragestellen des Ist-Zustandes unserer Arbeit. Nur wenn wir uns und andere immer wieder gegenseitig dazu ermahnen, wenn wir uns und andere fortwährend kritisieren und revolutionieren, werden wir verhindern, dass unsere Arbeit stagniert, erstarrt und sich verkrustete Strukturen herausbilden. Dazu gehört, dass wir die Mechanismen, die zur Strukturierung unserer Arbeit verwenden (wie z. B. Tagesordnungen, Berichte, ideologische Diskussionen u. a.) lebendig anwenden, um die Arbeit weiterzuentwickeln, anstatt diese in formale Rituale zu verwandeln und ansonsten nur das Nötigste zu machen. Ebenso gehört dazu, immer wieder ein richtiges Verhältnis zwischen der politischen Tagesarbeit der Organe und der gezielten Kader:innenarbeit herzustellen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen und Lehren aus der Geschichte, die wir anwenden können, um bürokratische Tendenzen bei uns, unseren Organisationen und in unserer politischen Arbeit zu bekämpfen.
Da die objektive Quelle für bürgerliches und bürokratisches Denken und Handeln in den Widersprüchen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und insbesondere der Trennung von leitenden und ausführenden Tätigkeiten liegt, ist es wichtig, dass wir diese Trennung immer wieder dort, wo das möglich ist, aufbrechen. Dies können wir z. B. tun, indem wir gerade, wenn wir leitende Funktionen ausführen – und das tun alle Kommunist:innen in der ein oder anderen Art – immer wieder andere Perspektiven einnehmen, aus unserer Komfortzone herausgehen, uns regelmäßig zusammen mit anderen an Aufgaben aus anderen Arbeitsbereichen und insbesondere einfachen Aufgaben der politischen Arbeit beteiligen, z. B. Flyer verteilen, Plakate kleben, Stammtische besuchen und den direkten Kontakt mit dem Umfeld suchen. Es ist kein Zufall, dass die Kommunistischen Parteien in einigen sozialistischen Ländern ihre führenden Funktionär:innen dazu verpflichteten, sich regelmäßig z. B. an der Feldarbeit in der Landwirtschaft zu beteiligen.
Wir müssen darüber hinaus unsere Kritik- und Selbstkritikkultur weiterentwickeln und uns nicht nur immer wieder in denselben Kollektiven kritisieren, sondern darüber hinaus aktiv Kritiken aus anderen Organen, von Genoss:innen, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und vor allem aus den Massen einholen. Letztlich müssen wir als Organisation, als Kollektiv und als revolutionäre Individuen eine Kultur entwickeln, mit der wir uns der Kritik aus den eigenen Reihen, aber auch der parteilosen Massen öffnen und diese aktiv fördern und einfordern. Dazu gehört zuallererst natürlich, dass wir diese Kritiken ernst nehmen, dass wir Konsequenzen daraus ziehen und kritisierte Dinge ändern, wo immer dies notwendig ist. Ebenso müssen Organe, die auf Dauer ihre Funktion nicht erfüllen, aufgelöst oder neu zusammengesetzt werden.
Regelmäßige Reflektion in unseren Kollektiven darüber, wo sich bürokratische aber auch liberalistische Tendenzen in der Arbeitsweise zeigen und bei denen wir konkrete Gegenmaßnahmen herausarbeiten, sind ebenfalls ein sehr wichtiges Element bei der Verbesserung unseres Arbeitsstils. Dazu gehört auch, die Wechselwirkung von Bürokratismus und Liberalismus ins Visier zu nehmen, die sich z. B. darin äußern kann, wenn Beschlüsse systematisch nicht eingehalten werden.
Allgemein müssen wir größtes Augenmerk darauf legen, Initiative bei uns und anderen und insbesondere in unserem Umfeld, an der Basis, zu fördern und dafür bewusst Räume zu schaffen. Dazu gehört auch die Vermittlung der dafür notwendigen Kompetenzen in Seminaren, praktischen Workshops usw.
Nicht zuletzt kann auch eine Rotation von Kader:innen bzw. ihren Aufgaben in bestimmten Bereichen (z. B. in einer Stadt) Sinn machen. Derartige technische Lösungen stellen zwar niemals ein Allheilmittel gegen Rückwärtsentwicklungen dar, können aber unsere Bemühungen unterstützen, Perspektivwechsel aktiv zu organisieren und damit Verkrustungen aufzubrechen.
Wir müssen uns dabei bewusst machen, dass der Bürokratismus einer ganz eigenen Dialektik unterliegt: Dieselben Maßnahmen können in unterschiedlichen Situation Bürokratismus fördern oder ihn bekämpfen. Welches Ergebnis sie zutage bringen, kommt sehr auf die Art und Weise ihrer Anwendung sowie auf die Intention an, was damit erreicht werden soll. Zum Beispiel kann das Rotieren von Aufgaben sowohl ein Mittel gegen eine eingefahrene bürokratische Routine darstellen – aber eben auch wieder selbst ein bürokratisches Mittel sein, welches eine effektive Arbeit verhindert.
Insgesamt stellt der Kampf um die Überwindung bürokratischer Tendenzen in unserer Arbeitsweise einen notwendigen Bestandteil der Revolutionierung der kommunistischen Bewegung, unserer Organisationen und jedes:r einzelnen dar. Bürokratische Organisationen werden nicht nur keinen Sozialismus aufbauen können, sondern werden gar nicht erst dahin kommen. Deshalb ist die Bekämpfung des Bürokratismus eine permanente Aufgabe für alle Revolutionär:innen.
1Foto Çami, „Der Bürokratismus – ein gefährlicher Feind des Sozialismus“, Albanien heute 4 / 1975
2Engels, „Anti-Dühring“, MEW 20, S. 166 f.
3Lenin, „Staat und Revolution“, LW 25, S. 398 f.
4„Die zentralisierte Staatsmacht, mit ihren allgegenwärtigen Organen stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand, Organe, geschaffen nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen Teilung der Arbeit – stammt her aus den Zeiten der absoluten Monarchie, wo sie der entstehenden Bourgeoisgesellschaft als eine mächtige Waffe in ihren Kämpfen gegen den Feudalismus diente.“, Karl Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW 17, S. 336
5Eugen Varga, „Der deutsche Imperialismus – die historischen Wurzeln seiner Besonderheiten“, Oberbaumverlag 1970, S. 23
6Vgl. Lenin, „Staat und Revolution“, S. 407 ff.
7Stalin, „Über die Aufgaben der Partei“, SW 5, S. 315 f.
8Vgl. Kommunismus 7, „Widerlegt?! Warum der Sozialismus in der Sowjetunion scheiterte“, Verlag Leo Jogiches, S. 12 ff.
9Vgl. Kommunismus 19, „Die Arbeiter:innenklasse als revolutionäres Subjekt“, S. 17 ff.
10Stalin, „Über die wirtschaftliche Lage der Sowjetunion und die Politik der Partei“, SW 8, S. 119
11Stalin, „Rede auf dem VIII. Kongreß des Kommunistischen Jugendverbandes“, SW 11, S. 63
12Siehe z. B. „The Stalin-Kaganovich Correspondence 1931-1936“, Yale University Press 2003, S. 127
13Vgl. Rote Reihe 1, „Wann und warum der Sozialismus in der Sowjetunion scheiterte“, Verlag Roter Morgen, S. 12
14Ossip A. Pjatnizki, „Die Bolschewisierung der kommunistischen Parteien der kapitalistischen Länder durch Überwindung der sozialdemokratischen Traditionen“, Bearbeitetes Stenogramm des Berichts Pjatnizkis auf der Beratung der Leiter für Parteiaufbau an den internationalen kommunistischen Parteischulen (1932), aus: Die Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition (RGO) Band 1, Verlag Rote Fahne (1973), S. 146 f.