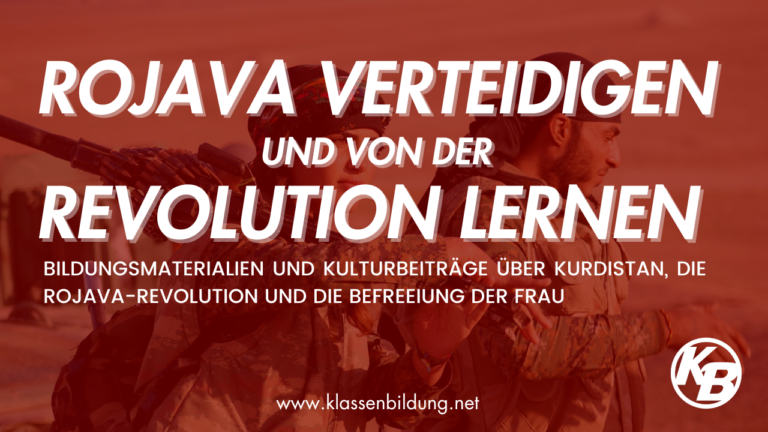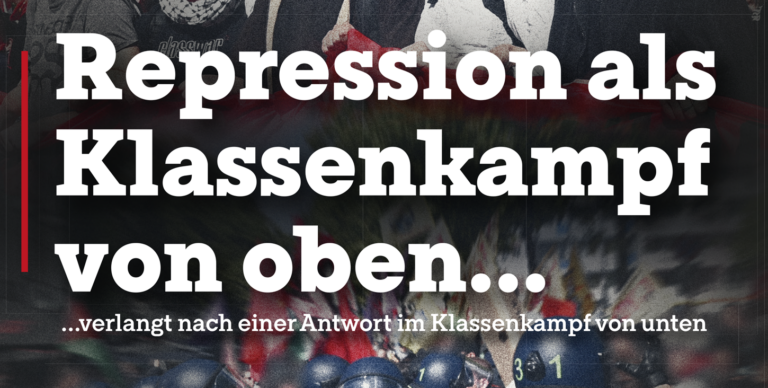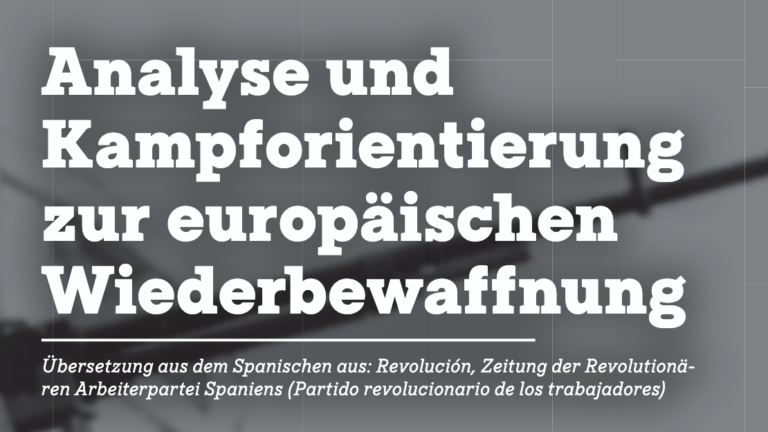Aus: Klassenkampf #3
Der Begriff der „Gegenmacht“ wird seit Jahrzehnten immer wieder in der breiteren Linken genutzt – bei einigen als griffige Worthülse, bei anderen, um damit das jeweils eigene strategische Konzept zu beschreiben. In den vergangenen Jahren haben dieser Begriff und die mit ihm verbundenen Konzepte in der politischen Widerstandsbewegung und Gewerkschaftsbewegung einen neuen Aufschwung genommen. Grund genug dafür, sich genauer mit seinen verschiedenen Ausprägungen zu beschäftigen.
Gegenmacht ist ein extrem dehnbarer, breiter Begriff, der heute von unterschiedlichen politischen Strömungen genutzt wird, die damit Verschiedenes verbinden. Zwar ist er vielerorts zu lesen, jedoch bleibt sein genauer Inhalt oftmals schwammig. Es gibt keine einheitliche Definition, sondern in jedem Fall muss konkret untersucht werden, was sich dahinter verbirgt. Zwischen den verschiedenen Gegenmachtvorstellungen besteht keine chinesische Mauer, sondern es gibt Übergänge von dem einen ins andere Lager und umgekehrt. Meist kommt sogar noch hinzu, dass das Wenige an niedergeschriebener Theorie dann in der Praxis wiederum keine zentrale Rolle spielt. Der Begriff der Gegenmacht wird dadurch oftmals zu einer beliebigen, „gefühlsmäßig“ verwendeten und eines konkreten Inhalts beraubten Phrase.
Dennoch wollen wir versuchen, uns nun sowohl der theoretischen Debatte um Gegenmacht als auch deren praktischen Konsequenzen zu nähern. Grob können wir dabei zwei Auslegungen unterscheiden:
Zum einen Gegenmacht als eine evolutionäre Strategie. Man findet sie im (DGB-)Gewerkschaftskontext, bei der (linken) Sozialdemokratie bis hin zu deren Parteispitzen sowie in revisionistischen Parteien. Auch verschiedene Gegenmachtkonzepte aus anarchistischen und autonomen Hintergründen können hierzu gezählt werden. Dabei geht es je nach Strömung darum, Kräfte für bürgerliche Machtpolitik, eine Reform des Kapitalismus oder eine graduelle Veränderung des Systems zu sammeln, ohne die bürgerliche Staatsmacht zerschlagen und revolutionär umgestalten zu wollen.
Zum anderen finden wir Gegenmacht als Konzept bei einem Teil der revolutionären und kommunistischen Bewegung: Bei Organisationen der 1960er und 70er Jahre, welche durch offensive Momente Gegenmacht schaffen wollten; bei revolutionären Kräften heute, welche unter diesem Label die politische Widerstandsbewegung nach links in Richtung Kommunismus ziehen möchten; sowie bei revolutionären Kräften, welche damit eine proletarische Massenverankerung meinen, ohne jedoch den Aufbau der Kommunistischen Partei direkt anzugehen. In diesen Fällen geht es darum, Staat und Kapital eine kämpferische Haltung entgegenzusetzen, wenngleich es letztlich an einer konsequenten und allseitigen Strategie zur revolutionären Machteroberung fehlt, bzw. die dafür notwendigen Schritte – wie etwa der Aufbau einer Kommunistischen Partei – heute nicht verfolgt werden.
Auch wenn es natürlich Unterschiede zwischen den Gegenmachtkonzepten bei offenen Reformist:innen und dem von Revolutionär:innen gibt, enden sie alle auf ihre Art in einer strategischen Sackgasse. Das liegt daran, dass in allen Varianten – obwohl von Gegenmacht gesprochen wird, die entscheidende Frage der Eroberung der Macht durch die Arbeiter:innenklasse und ihre kommunistische Vorhut in der einen oder anderen Form umgangen wird oder sich nicht konsequent im eigenen Aufbaukonzept widerspiegelt.
Um herzuleiten, warum jedoch genau das notwendig ist, wollen wir kurz die Grundsätze zur Frage der gesellschaftlichen Macht aus marxistisch-leninistischer Sicht darlegen:
Macht in Klassengesellschaften ist aus marxistischer Perspektive kein unerklärliches Phänomen, welches sich aus der „Natur des Menschen“ ergibt. Es ist ein soziales Verhältnis, in welchem eine Klasse geistig und materiell über eine oder mehrere andere Klasse(n), herrscht. Dieses soziale Verhältnis wird entscheidend durch die jeweiligen Produktionsverhältnisse und die ökonomische Gesellschaftsformation als ganzes bestimmt. Je nach Stellung zu den Produktionsmitteln, der Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum und den Produktionsprozess als ganzes hat eine Klasse unterschiedliche Macht. Auch die Frage, wie die Arbeitskraft produziert und reproduziert wird – und damit die Frage des Patriarchats – prägt die Ökonomie und damit grundlegende Machtverhältnisse, in dem Fall die gesellschaftliche Herrschaft des Mannes über die Frau.
In tiefer Prägung durch diese Produktionsverhältnisse und das Patriarchat und darauf aufbauend entwickelt sich ein gesellschaftlicher Überbau, der sowohl politische Herrschaftsinstrumente wie den Staat als auch die herrschenden geistigen Anschauungen (die Ideologie) umfasst. Aufgrund ihrer Stellung zu den Produktionsverhältnissen – nämlich als Eigentümer:innen der Produktionsmittel – hat im Kapitalismus die Bourgeoisie somit auch die Macht im Überbau inne und ist dadurch die herrschende Klasse.
Heute liegt diese Macht in Deutschland in den Händen der deutschen Monopolbourgeoisie. Diese übt sie durch den Staatsapparat aus, der mit seinen Zwangsinstrumenten wie Polizei und Gefängnissen die Eigentumsverhältnisse nach innen absichert und mit der Bundeswehr die ökonomischen und politischen Interessen nach außen gegenüber anderen Konkurrenten durchsetzt.
Diese Repression wird durch integrative Maßnahmen ergänzt: So werden die Unterdrückten mit Hilfe der bürgerlichen Ideologie an das System so gebunden, dass sie ihrer Unterdrückung „freiwillig“ zustimmen und mit der parlamentarischen Demokratie und weiteren Stellvertreterinstitutionen „mitbestimmen“, ohne jemals tatsächlichen Einfluss zu nehmen. Zugleich kann Deutschland als führendes imperialistisches Land auch ökonomische Zugeständnisse machen, um diese Integration materiell abzusichern. Solche integrativen Maßnahmen können aufgrund der dauerhaften Krisen des kapitalistischen Systems jedoch immer nur vorübergehend sein. Wie wir heute sehen können, tendiert dieses System zur Verschärfung zwischenimperialistischer und ökonomischer Widersprüche, was sich in schweren Wirtschaftskrisen, Faschismus und Kriegen bis hin zu Weltkriegen zeigt.
Als Kommunist:innen wollen wir deshalb mit diesen kapitalistischen Produktionsverhältnissen grundsätzlich Schluss machen. Dafür ist es notwendig, dass die Arbeiter:innenklasse der Bourgeoisie die Produktionsmittel entreißt – etwas, was diese mit allen ihr zur Verfügung stehenden Machtmitteln, insbesondere den Zwangsinstrumenten des Staats, versuchen wird zu verhindern. Aus diesem Grund muss die Arbeiter:innenklasse den Staatsapparat in einer notwendigerweise gewaltvollen Revolution zerschlagen, die Bourgeoisie enteignen und sowohl die Ökonomie als auch die Politik in die eigenen Hände nehmen. Das bedeutet, die politische Macht in Form eines proletarischen Staats auszuüben und in einem sozialistischen Aufbauprozess nicht nur die Bourgeoisie niederzuhalten, sondern auch die Arbeiter:innenklasse immer mehr in die Gestaltung und Verwaltung der Gesellschaft mit einzubeziehen und durch die Frauenrevolution das Patriarchat zurückzudrängen. Das legt die Voraussetzungen dafür, nach einem weltweiten Sieg des Sozialismus, im Kommunismus, jegliche Herrschaft des Menschen über den Menschen zu überwinden.
Die proletarische Revolution wird die Arbeiter:innenklasse jedoch nicht spontan durchführen. Sie kann Aufstände organisieren und Regierungen stürzen, wie es in den letzten Jahrzehnten immer wieder geschehen ist. Doch um die Produktionsverhältnisse umzuwälzen, benötigt sie eine klare Strategie und ein eigenes Instrument zu ihrer Befreiung – eine Kommunistische Partei. In dieser sammeln sich die konsequentesten Kämpfer:innen für die Sache der Arbeiter:innen und organisieren sich so, dass sie von diesem Staatsapparat nicht zerschlagen werden, sondern im Gegenteil die Vorbereitungen dafür treffen, selbst als Kampfstab der Klasse in der Revolution den bürgerlichen Staat zu besiegen. Eine solche Kommunistische Partei fällt jedoch nicht von Himmel oder entsteht spontan von unten im Prozess des Gegenmachtaufbaus. Sie bewusst aufzubauen ist die zentrale Aufgabe von Kommunist:innen heute.
Diese marxistischen Grundprinzipien halten wir nach wie vor für den Kern, an dem sich eine Strategie für die Befreiung der Ausgebeuteten und Unterdrückten orientieren muss. Das sehen nicht alle so: Theoretiker:innen wie beispielsweise Eduard Bernstein (1850-1932), Pjotr Alexejewitsch Kropotkin (1842-1921), Antonio Negri (1933-2023) oder John Holloway (*1947) haben diese Prinzipien angegriffen und versucht, die Frage der Machteroberung zu umgehen. Im folgenden wollen wir uns unter anderem deren Thesen sowie davon beeinflusste politische Kräfte weiter ansehen und die marxistisch-leninistischen Grundprinzipien demgegenüber entwickeln. Dabei werden wir uns vom Aufbau her an den oben genannten Ausprägungen von Gegenmacht (als „evolutionäre“ Strategie und als Strategie innerhalb der revolutionären Bewegung) und deren politischen Vertreter:innen orientieren. Anschließend werden wir die Ergebnisse kurz zusammenfassen.
Gegenmacht statt Eroberung der Macht
Gegenmacht in Sozialdemokratie und modernem Revisionismus
Gegenmacht findet sich heute als geflügeltes Wort in der gesamten Breite der (linken) Sozialdemokratie: Von der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) über die Linkspartei bis hin zu führenden Vertreter:innen der Monopol-Partei SPD bedient man sich dieser Worthülse. Die damit einhergehenden politisch-strategischen Vorstellungen wurden dabei – wenn auch noch nicht unter diesem Begriff – schon vor langer Zeit diskutiert.
„Die Bewegung ist alles, das Endziel ist nichts“1 – mit diesem Satz brachte der Urvater des Revisionismus, Eduard Bernstein (1850-1932), seinen Strategievorschlag für die frühe Sozialdemokratie Ende des 19. Jahrhunderts auf den Punkt. Er verlangte, dass die Vorstellung eines notwendigen revolutionären Umsturzes verworfen und stattdessen eine evolutionäre Gesellschaftsumwälzung angestrebt werden sollte. Diese sei gerade aufgrund der immer weiter wachsenden Stärke der Arbeiter:innenklasse und der sozialdemokratischen Institutionen „über eine plurale demokratische Gegenmacht qua Stimmzettel und Selbstverwaltung zu erreichen“2. Somit könne dann eine immer weitergehende Demokratisierung und Teilhabe an der Gesellschaft durchgesetzt und dann eine soziale Ordnung aufgebaut werden. Und tatsächlich war die Sozialdemokratie zu diesem Zeitpunkt gesellschaftlich so breit verankert, hatte so viele eigene kulturelle, politische und sogar ökonomische Institutionen und vor allem eine so starke Sympathie mit dem Sozialismus geschaffen wie nie zuvor. Doch aus dem Ziel, diese eroberte Position zur Zerschlagung der Kapitals zu nutzen, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts (spätestens ab dem Jahr 1906) mit dem Rechtsschwenk innerhalb der SPD das Vorhaben, selbst an der Machtausübung innerhalb des kapitalistischen Systems beteiligt zu sein. Der Verzicht auf die revolutionäre Machtübernahme führte nicht zum Sozialismus, sondern hinein in die Mitverwaltung des deutschen Imperialismus nach dem Ersten Weltkrieg.
In der Weimarer Republik ging es der sich verbürgerlichenden Sozialdemokratie dann nicht mehr um eine Emanzipation der Arbeiter:innenklasse. Sie war bereits offen auf die Seite des Erhalts und der stückweisen „Modernisierung“ der kapitalistischen Herrschaft übergegangen. So wurden die Organe der Arbeiter:innenbewegung wie die Gewerkschaften und die in der Novemberrevolution geschaffenen Räte durch den neu geschaffenen ADGB und das Betriebsrätegesetz immer fester in das bürgerlich-demokratische System integriert. Sie wurden zu Institutionen, welche bestimmte Zugeständnisse aus einer begrenzten ökonomistisch-gewerkschaftlichen Position organisieren, ohne das System grundlegend in Frage zu stellen und es damit sogar stabilisieren, die Zustimmung der Beherrschten zu den Maßnahmen der Herrschenden herstellen und somit die freiwillige Unterordnung der Unterdrückten garantieren. Ideologisch wurde dieser Schwenk unter dem Banner der „Wirtschaftsdemokratie“3 gerechtfertigt, welcher die Verstaatlichung zentraler Industriezweige innerhalb des Kapitalismus bei wachsender Mitbestimmung des ADGB vorsah. Gegen das Kapital durchgesetzt wurde dies jedoch nie.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann von bürgerlich-liberalen Kräften diese mittlerweile international gefestigten integrativen Institutionen als dauerhafte Notwendigkeit theoretisiert. So forderte der US-Stratege und Berater verschiedener demokratischer US-Präsidenten, John Kenneth Galbraith (1908-2006) im Jahr 1952, dass staatliche Institutionen und Gewerkschaften als Gegenmacht („countervailing powers“) zu Großkonzernen fungieren müssten, sodass der Kapitalismus als Ganzes am Leben erhalten werden könne.4
Ähnlich zeigte sich dies in der deutschen Gewerkschaftsdebatte. So wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) von vornherein so aufgebaut, dass er Millionen Arbeiter:innen systematisch in die kapitalistische Herrschaft integrieren konnte. Die im industriell stärksten Sektor eingeführte Montanmitbestimmung wurde zum Modell der deutschen Sozialpartnerschaft, worauf schon früh die bis 1996 existierende IG Bau-Steine-Erden unter Georg Leber setzte.56
Unter dem langjährigen Gewerkschaftsvorsitzenden Otto Brenner (1907-1972) wollte sich die IG Metall derweil mehr als gewerkschaftliche Gegenmacht auf der Linie der Wirtschaftsdemokratie, jedoch ohne umstürzlerische Absichten, verstehen.7 Brenner war von dem bekannten Politologen und späteren DKP-Ideologen8 Wolfgang Abendroth (1906-1985) beeinflusst.Einst KPD-Mitglied, später Mitglied der KPD-Opposition, wurde dieser nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem führenden Vertreter des modernen Revisionismus9 und zugleich einflussreicher Wegbereiter des Reformismus in den sozialen Bewegungen und Universitäten. Abendroth bezeichnete den wesentlichen Gehalt des Grundgesetzes als „die Garantie der Möglichkeit zu legaler Transformation der sozialökonomischen und soziokulturellen Basis in Richtung auf eine sozialistische Gesellschaft, die auch real (und nicht nur juristisch-fiktiv) wirklich allen gleiche Rechte gewährt.“10 Er theoretisierte die reformistische Illusion, den Sozialismus auf friedlichem Wege einführen zu können. Auf dieser Linie positionierte sich dann auch die 1968 unter Zustimmung des Innenministeriums neu gegründete Deutsche Kommunistische Partei(DKP). Sie stand damit in der Tradition des modernen Revisionismus, der sich europaweit in den 60er und 70er Jahren ausgehend von der Sowjetunion durchsetzte. Stolz erklärt die DKP dazu noch heute, sie sei von Anfang an für eine „Demokratisierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft“ eingetreten, „die den Weg zum Sozialismus öffnen sollte. Die junge DKP erkämpfte sich ihren Platz in den Klassenkämpfen – sie war die konsequenteste Partei der „Gegenmacht“, weil sie die Partei des Sozialismus war.“11 Wie genau sich die DKP diesen Prozess des revisionistischen Gegenmachtaufbaus vorstellte, findet sich auch noch in ihrem 2006 aktualisierten Programm wieder. Ziel sei es, ein starkes „Übergewicht der eigenen Seite“ zu schaffen: „Durch die Stärkung der Organisation und Kampffähigkeit der Gewerkschaften, durch betriebliche und gewerkschaftliche Aktionen, durch die Aktivitäten demokratischer und sozialer Bewegungen muss Gegenmacht aufgebaut werden. (…) [Dies ermöglicht die] Zurückdrängung der Macht des Monopolkapitals und für die Öffnung des Weges zum Sozialismus“12. Dadurch könne man sogar die Gegenseite an der Ausübung von Gewalt hindern.
Hier kondensiert sich am klarsten, wie wenig dieser Gegenmachtaufbau zur tatsächlichen Emanzipation der Arbeiter:innenklasse führen kann. Ob in den 20ern, den 70ern oder heute – ein friedlicher Übergang zum Sozialismus ist im Anblick einer Bourgeoisie, welche zwei Weltkriege losgetreten hat und heute wieder mit Militarisierung nach innen und außen vorgeht, reine Illusion. Wer die Frage der Revolution und damit die Machtfrage durch eine Gegenmachtfrage ersetzt, hilft damit also nicht unserer Befreiung sondern stiftet Verwirrung.13
Der Begriff der Gegenmacht wird heute auch als Agitationsbegriff in den „kämpferischen Sonntagsreden der den deutschen Imperialismus regierenden Sozialdemokratie genutzt: Beim Bundesparteitag 2009 erklärte der damalige Fraktionsvorsitzende und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (*1956): „Darum, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir Sozialdemokraten eine Gegenmacht sein und Druck organisieren: mit einer harten Opposition im Parlament, in der ganzen Gesellschaft.“14 Ein Jahr später betonte auch Sigmar Gabriel (*1959) – heute bei Rheinmetall im Aufsichtsrat: „Gegenmacht sein und um Mehrheiten kämpfen, ist für die deutsche Sozialdemokratie eine Daueraufgabe“15.
Dasselbe gilt heute noch ähnlich für den DGB und ihm angegliederte Gewerkschaften. Zum 125-jährigen IG Metall-Jubiläum erklärte diese, sie verstehe sich als „politische Gegenmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, nur um kurz darauf festzustellen: „Ohne Mitbestimmung, gelebte Tarifautonomie und einen aktiven Sozialstaat wäre das politische und ökonomische ‚Erfolgsmodell Bundesrepublik‘ nicht möglich gewesen“16. Eine „Gegenmacht“ der Arbeiter:innen, welche sich dafür rühmt, zum ökonomischen Aufstieg des deutschen Imperialismus beigetragen zu haben? Das ist letztendlich die Konsequenz, wenn man in der Machtfrage immer weiter nach rechts geht, bis man im Lager der Bourgeoisie angekommen ist.
Im Gewerkschaftskontext wird der Begriff der Gegenmacht auch heute weiter diskutiert, jedoch oftmals ökonomistisch eingeengt und somit politisch noch weiter entschärft. In was für engen Bahnen dabei gedacht wird, zeigt sich auch bei den „linken“ Vertreter:innen innerhalb des DGB, wie beispielhaft bei den Autor:innen des Buchs „Gegenmacht statt Ohnmacht“17. Dort heißt es schon auf dem Buchrücken: „Es ist das Betriebsverfassungsgesetz, in dem wir Antworten (…) finden. Es legt fest, in welchem Umfang Arbeitnehmer*innen Gegenmacht aufbauen können.“ Das Betriebsverfassungsgesetz – gegen dessen Verabschiedung viele fortschrittliche Gewerkschafter:innen im Jahr 1952 gekämpft haben – als Rahmen für den Umfang von Gegenmacht? Schon diese Selbstbeschränkung dürfte langfristig vor allem zu Ohnmacht führen.
Ähnliches zeigt sich bei linkssozialdemokratischen Teilen im DGB, welche sich rund um den „Organizing“-Ansatz als „Revitalisierungsmethode“ für die Gewerkschaften sammeln. Hier wird sich meist auf Jane McAlevy (1964-2024) bezogen, die in Organizing-Kontexten als Gegenmacht-Koryphäe gefeiert wird. Die IG-Metall-Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz schreibt dazu: „Nach McAlevey sind wichtige Elemente des Aufbaus echter Gegenmacht: die Nutzung inner- wie außerbetrieblicher Netzwerke der Beschäftigten, ihre Mitwirkung an der Strategieentwicklung und die direkte Teilnahme der Beschäftigten an Tarifverhandlungen. Organizing bedeutet Aufbau von systematischer Gegenmacht. Deshalb steckt im Organizing sehr viel Potenzial für die Erneuerung bzw. Modernisierung der Gewerkschaftsarbeit.“18 Auch wenn McAleveys Methodenkoffer der Arbeitskämpfe auch für Kommunist:innen interessante Ansätze enthält – was hier unter „echter Gegenmacht“ verstanden wird, ist eine aktivere Einbindung von Arbeiter:innen in den alltäglichen Zirkus der Sozialpartnerschaft und keine Strategie zur Emanzipation des Proletariats. Hier will man vielleicht eine Macht „gegen“ einzelne Entscheidungen des Unternehmers aufbauen, aber keine Macht „für“ eine grundlegende Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Derselbe Fehler bleibt nicht nur auf den betrieblichen Bereich begrenzt. Auch wer den Aufbau von Gegenmacht auf Stadtteilpolitik, Frauenkampf, Antifaschismus oder den kulturellen Bereich reduziert – und sei es aus eigener Schwäche – theoretisiert damit die eigene Begrenzung, anstatt eine umfassende revolutionäre Strategie zu entwickeln.
Anarchosyndikalistische Gegenmacht – wenn Ideologie zur Niederlage führt
Der Aufbau von Gegenmacht wird von manchen Strömungen der politischen Linken jedoch auch als grundsätzlich antagonistisch zum Staat und seinen Strukturen verstanden – so etwa im Anarchismus. In ihrem Grundlagenwerk „Schwarze Flamme“ bringen Lucien Van den Walt (*1972) und Michael Schmidt (*1966) dies wie folgt auf den Punkt: „Im Mittelpunkt der massenanarchistischen Tradition steht die Vorstellung, dass es notwendig sei, eine revolutionäre Volksbewegung aufzubauen – und zwar zentriert um eine revolutionäre Gegenkultur und den Aufbau von Organen der Gegenmacht –, um die Grundlagen für eine neue Gesellschaftsordnung zu legen, die Kapitalismus, Grundbesitz und Staat ersetzt.“19
Mit der „massenanarchistischen Tradition“ beziehen sie sich auf anarchistische Vordenker wie Pjotr Alexejewitsch Kropotkin (1842-1921). Laut Kropotkin könne die Revolution nur „eine volksnahe Bewegung“ sein, „in der das Volk in jeder Stadt, in jedem Dorf (…) den Neuaufbau der gesellschaftlichen Organisation selbst in die Hand nimmt“20 – und durch Assoziationen ersetzt, die nach demokratischen und antihierarchischen Prinzipien funktionieren. Die Gegenmacht soll außerhalb und im Gegensatz zum Staatsapparat aufgebaut werden, und eine revolutionäre Gegenkultur geschaffen werden.
Eine der relevantesten Strömungen innerhalb des Anarchismus ist der Anarchosyndikalismus, der eine „revolutionäre Gegenmacht“ durch „Alltagskämpfe“21 aufbauen möchte, bei welchen eigene Gewerkschaften im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.22 Der betriebliche Kampf wird als Haupthebel zur Veränderung des Systems gesehen.
Wie sah das in der historischen Praxis aus? Eine der einflussreichsten anarchosyndikalistischen Gewerkschaften waren Anfang des 20. Jahrhunderts die Industrial Workers of the World(IWW). Sie organisierten hunderttausende Arbeiter:innen und führten große Massenstreiks in den USA durch. „Indem wir uns industriell organisieren, bilden wir die Struktur der neuen Gesellschaft in der Schale der alten Gesellschaft“23 – so hatten sie ihre Strategie 1909 in der Präambel ihres Grundlagendokuments zusammengefasst. Doch wie genau die neue Gesellschaft dann zur Macht kommt, wird von den IWW umschifft und faktisch ein graduelles Wachstum der Organisierung entworfen, bei dem die soziale Revolution an die eigene Entwicklung gekoppelt wird: Indem man immer mehr Arbeiter:innen in Arbeiterkomitees organisiert, würde man dem Kapital durch den Lohnkampf immer mehr Mehrwert abknöpfen und damit ihre Macht aushöhlen. Dies müsse so weitergehen, bis die überwältigende Mehrheit der Arbeiter:innen organisiert sei und man die bereits gewachsene Kontrolle über die Industrie durch Arbeiterassoziationen nur mit einem Generalstreik in Kraft setzen müsse. Umgekehrt wurde dann auch der bewaffnete Aufstand sowie grundsätzlich „Politik“ innerhalb der Gewerkschaft abgelehnt.24 Dieser Ansatz ist aus mehreren Gründen falsch:
- Die Arbeiter:innenklasse gerät eben nicht nur im Betrieb und im Kampf um den Lohn in einen Widerspruch zum System, sondern an allen Stellen, wo sie lebt und arbeitet (z. B. im Bildungssystem, am Wohnort usw.). Hinzu kommen andere Orte der Auseinandersetzung wie das Parlament, die Armee usw. Sich deshalb auf eine Gewerkschaft als einzige Organisationsform zu begrenzen, macht eine einzige relevante Organisationsform zur ausschließlichen Strategie.
- Hinzu kommt, dass der explizit anti-„politische“ Ansatz den Kampf um politische Losungen der Klasse vernachlässigt, wobei eben gerade der Kampf gegen Krieg, Faschismus, Patriarchat usw. besondere Politisierungsmöglichkeiten bietet und mit dem ökonomischen Kampf verbunden werden muss.
- Zudem entspricht die Vorstellung von einem graduellen Aufbau von Gegenmacht einem falschen Entwicklungsverständnis. Eine Revolution wird niemals so gestaltet sein, dass man wahlweise 51% oder 100 % der Arbeiter:innenklasse für seine Position gewinnt und dann Stück für Stück in den Kommunismus hinüberwächst. Es muss stattdessen eine revolutionäre Situation vorliegen (die Herrschenden können nicht mehr wie bisher regieren; die Beherrschten wollen nicht mehr wie bisher regiert werden; ihre Unterdrückung steigert sich massiv über das gewohnte Maß hinaus). Diese muss außerdem von den Kommunist:innen und den fortgeschrittensten Teilen der Arbeiter:innenklasse genutzt werden, um die sozialistische Revolution durchzuführen.
- Zuletzt ist eine Gewerkschaft als möglichst offene und von starker Fluktuation geprägte Organisationsform für den Kampf gegen einen hochgerüsteten Gegner schlecht geeignet, da diese feste, dauerhafte, ideologisch klare und konspirative Organisationsformen auf Seiten der Revolutionär:innen notwendig macht.
Während sich die IWW also als die radikalsten Vorkämpfer:innen einer klassenlosen Gesellschaft präsentierten, landeten sie mit ihrer Politik insgesamt bei einer Art „anarchistischem Reformismus“. Dies ist ein Beispiel dafür, wie nah scheinbar entgegengesetzte Kräfte wie Anarchosyndikalist:innen und Sozialdemokrat:innen sich dann doch bei ihren verschiedenen Gegenmachtkonzepten kommen.
Letztendlich ist die Organisation dann auch an diesem Widerspruch zerbrochen, da ein Teil den Weg der Unklarheit nicht mehr weitergehen wollte. Unter dem Druck der Repression und des wachsenden Einflusses des Bolschewismus als klarer, strategisch ausgerichteter Kraft spaltete sich die Organisation 1923. Ein Teil schloss sich der KPUSA25 an und der Anarchosyndikalismus verlor in den USA stark an Einfluss.
Insgesamt war die anarchistische Bewegung weltweit im 20. Jahrhundert zwar eine politische Minderheitenströmung, jedoch in einzelnen Ländern durchaus stark präsent, etwa in Spanien.26 Noch heute beziehen sich viele Anarchist:innen auf die dort erschaffene anarchistische Gegenmacht.
Hier wurde 1931 die Zweite Republik als bürgerliche Demokratie ausgerufen. Diese war von Richtungskämpfen zwischen Rechten, Liberalen, Sozialdemokrat:innen, Kommunis:tinnen und Anarchist:innen um die Ausrichtung und den weiteren Weg geprägt. Führend unter den Anarchist:innen war hier die Confederación Nacional del Trabajo (CNT), eine Föderation anarchosyndikalistischer Gewerkschaften. 1936 kam es zum Putsch rechter Militärs unter Francisco Franco (1892-1975) gegen die republikanische Regierung. Dieser führte zu landesweiten antifaschistischen Kämpfen, an denen sich auch die CNT beteiligte. Über den antifaschistischen Kampf hinaus verfolgte die CNT in ihren Hochburgen Katalonien und Andalusien das Ziel, sofort den „freien Kommunismus“ umzusetzen: Anarchist:innen besetzten Fabriken, kollektivierten Ländereien und errichteten Kommunen. Die notwendigen Voraussetzungen für eine Revolution, nämlich die Faschist:innen zuerst zu zerschlagen und die Macht im Staat zu erobern, wollten sie dabei „überspringen“. Auch wenn sie, dort wo sie waren, kämpften, stellten sie sich gegen den Aufbau von umfassenden und übergreifenden militärischen Organisationen für den Bürgerkrieg im ganzen Land zur Niederschlagung der Faschist:innen.27 Letztendlich gewannen die Franco-Faschist:innen, errichteten eine fast vierzigjährige Diktatur und schlugen alle Projekte der anarchistischen Gegenmacht, des kommunistischen Widerstands zusammen mit der demokratischen Republik blutig nieder.
Wir können also sehen, wie die anarchosyndikalistische Variante des Gegenmachtaufbaus in der Geschichte zwar untersuchenswerte Erfahrungen im selbstorganisierten Widerstand gegen das Kapital hervorgebracht hat – jedoch aufgrund ihrer ideologischen Grenzen letztendlich dabei stehenbleibt und zur Niederlage führt.
Die grundsätzliche Ablehnung der Ausübung von „Macht“ und „Autorität“ bringt die Anarchist:innen immer wieder in Widerspruch mit der Realität. Ihre Weigerung, tatsächlich die Macht zu erobern und einen proletarischen Staat als Übergangsgesellschaft auf dem Weg zum Kommunismus aufzubauen, führt am Ende dazu, dass ihr Ziel der Abschaffung der Herrschaft des Menschen über den Menschen niemals erreicht werden kann. Es fehlt sowohl an einer konsequenten Strategie, um die gegnerische Staatsmacht zu zerschlagen, als auch die Gegner:innen nach einer Revolution organisiert niederzuhalten und eine neue Gesellschaft planmäßig aufzubauen.
Die Arbeiter:innenklasse muss schon heute im Rahmen des Kampfes um die politische Macht lernen, selbstständig zu agieren, um nach der Revolution in der Lage zu sein, auch tatsächlich eine ganze Gesellschaft zu organisieren. Hierfür ist neben dem Aufbau einer zentralisierten Kampforganisation auch die Schaffung von Massenorganisationen notwendig – dort, wo die Klasse lebt und arbeitet.
Gegenmacht ohne Leninismus und proletarischen Staat?
In dem Maße, wie sich der Revisionismus in der kommunistischen Bewegung durchsetzte und auch anarchistische Strategien erfolglos blieben, stießen neue Theoretiker:innen in Debatten um den Aufbau von Gegenmacht. Diese vermischten oftmals anarchistische und marxistische Theoriefragmente und brachten diese mit Versatzstücken des Postmodernismus zusammen. Einig waren sie sich jedoch in der Ablehnung von proletarischer Diktatur und leninistischem Parteiaufbau.
Postoperaismus als radikal-demokratischer Reformismus
Ein Beispiel dafür ist die Theorie des Postoperaismus.28 Exemplarisch wird diese Theorie im Buch „Empire“von Michael Hardt (*1960) und Antonio Negri (1933-2023) dargelegt, welches im Jahr 2000 erschien. Dieses wurde von dem postmodernen Ideologen Slavoj Žižek (*1949) als „Kommunistisches Manifest des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. In diesem erklären sie, dass der Imperialismus durch das „Empire“ abgelöst worden sei, einer globalen Struktur von Weltherrschaft, welche die Nationalstaaten und ihre Bedeutung überwinde. Auch die materielle Produktion und das Wertgesetz würden nicht mehr die Rolle spielen, die Marx ihnen zugewiesen hatte. Nun sei die „immaterielle“ und „kommunikative“ Arbeit zentral geworden. In diesem Zusammenhang wollen die Autoren die Verengung auf die Industriearbeiter:innen überwinden, werfen jedoch gleich den ganzen Klassenstandpunkt über Bord und sehen stattdessen eine diffuse „Multitude“ als Subjekt der Veränderung. Deren Basis sei nicht ein gemeinsames objektives Klasseninteresse, sondern das gemeinsame Handeln in Bewegung. Ziel sei ein – in und durch diese Multitude zu erschaffender – erneuerter Kommunismus, nicht mehr als äußere Opposition gegen ein zentrales Machtzentrum, sondern als produktive, vernetzte Kraft von unten, welche inmitten der Gesellschaft neue Formen des Zusammenlebens und Wirtschaftens, die sogenannten „Commons“ entwickelt. In dieser Theorie wird jedes Stück Bewegung aus sich heraus nicht nur zur Gegenmacht, sondern dem Keim einer Doppelmacht, und das explizit ohne Partei, was sich etwa in Negris Analyse der Gelbwestenbewegung (2018/2019) in Frankreich zeigt.
Bei den Gelbwesten handelte es sich um eine Massenbewegung mit einer Reihe an heftigen Protesten, welche sich zwar anhand der erhöhten Besteuerung von Diesel entzündeten, jedoch bald allgemeine Fragen von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit auf die Straße brachten und sich zugleich weigerten, mit dem Staat in Verhandlungen darüber zu treten. Vier Wochen nach dem Beginn dieser Bewegung wies Negri darauf hin, dass es Organisierung brauche, um weiterzukommen, aber – „wenn wir Organisation sagen, dann meinen wir nicht die Parteiform.(…). Eine autonome Multitude kann als Gegenmacht fungieren das heißt, als eine Vision, welche in der Lage ist über lange Zeit und schwerwiegend auf die „Regierung des Kapitals“ Druck auszuüben (…) Selbst wenn es keine Möglichkeit für die Multitude gibt an die Macht zu kommen, dann gibt es dennoch die Möglichkeit eine aufständische Bewegung offen zu halten. Diese Situation wurde früher mit dem Begriff „Doppelmacht“ beschrieben: Macht gegen Macht. Die Ereignisse in Frankreich bestätigen uns nur eins mit Sicherheit: es ist nicht länger möglich, diese Beziehung zu beenden. Die „Doppelmacht“ wird bleiben und für eine lange Zeit existieren, entweder latent oder – so wie derzeit – in seiner offenen, manifestierten Form. Die Aufgabe der Militanten wird es nun sein, neue Formen der Solidarität um neue Ziele zu schaffen, welche in der Lage sind, die „Gegenmacht“ zu füttern. Das ist der einzige Weg, wie die Multitude zur Klasse werden kann.“29
Hier zeigt sich beispielhaft, wie das Konzept der Gegenmacht Verwirrung stiftet. Die politisch heterogene Bewegung der Gelbwesten, in welcher keine politische Kraft dauerhaft führend werden konnte, wird als das beschrieben, was früher die „Doppelmacht“ gewesen sei. Phasen der „Doppelmacht“ waren solche wie in Russland zwischen der Februarrevolution 1917 und der Oktoberrevolution 1917, in welcher eine Rätemacht unter dem immer stärker werdenden Einfluss der Bolschewiki bestand, welche mit dem alten Staat um die Herrschaft kämpfte. Ähnlich war es in Deutschland rund um die Novemberrevolution 1918. Eine solche Situation lag in der Phase der Gelbwestenbewegung jedoch in keiner Weise vor. Es war ein zwar massenhafter und kämpferischer längerer Protest, der jedoch keine Aussicht auf eine grundsätzliche Machteroberung hatte, da es an einem entsprechenden Programm, einer entsprechenden Organisation sowie der Ausweitung in andere Teile der Gesellschaft und insbesondere die Betriebe mangelte. Dies wird von Negri bewusst verwischt, wenn er Gegenmacht als organisatorische Alternative zur Partei entwickelt, ohne jedoch in irgendeiner Form darzustellen, wie aus dieser Gegenmacht eine Perspektive der Machteroberung geschaffen werden soll.
Hinzu kommt: Die Phase der Doppelmacht kann – zumindest in imperialistischen Zentren – heute nicht lange anhalten. Die Frage: „Wer besiegt wen“ drängt hier zur Entscheidung. Die Hintergründe davon sind vielfältig: Aufgrund der nationalen und internationalen Vernetzung der Wirtschaft hätten beispielsweise Werksbesetzungen und Enteignungen sofort weitreichende Auswirkungen auf den Alltag (bspw. die Lebensmittelversorgung) und sogar die Just-in-Time-Produktion in anderen Teilen der Welt. Ein revolutionärer Aufstand würde aufgrund der modernen Kommunikationsmittel innerhalb weniger Stunden im ganzen Land bekannt sein und somit eine noch schnellere Reaktion der Gegenseite verlangen, um eine weitere Verbreitung zu vermeiden. Der Staat organisiert heute so allumfassend das Leben seiner Bürger:innen, dass die dauerhafte Aufhebung seiner Autorität ein großes Vakuum hinterlassen würde, das schnell vollständig gefüllt werden müsste: Nämlich entweder vom alten Staat oder der Arbeiter:innenmacht. Eine solche Situation lag in Frankreich jedoch zu keinem Zeitpunkt vor. Dass die Zeit rund um die Gelbwestenproteste „dauerhaft“ als Gegenmacht bestehen bleiben soll, widerspricht der tatsächlichen Entwicklung der Bewegung. Dies zeigt auf, dass es den Theoretiker:innen der „Gegenmacht“ nicht nur an klaren Analysen von Bewegungen mangelt, sondern durch ihre „Theoretisierung“ eine tatsächliche Auseinandersetzung mit der Machteroberung verhindert wird. Gerade ihre dogmatische Ablehnung einer Arbeiter:innenpartei ist ein Kernelement dieser falschen Theorie.
Seine Ausläufer findet dieser radikaldemokratische Reformismus auch in der politischen Widerstandsbewegung in Deutschland. Beispielhaft dafür steht die interventionistische Linke (iL), welche schon bei ihrer Gründung stark von den Thesen von Hardt und Negri beeinflusst war. In ihrem aktuellen Zwischenstandspapier von 2024 schreibt sie, sie wolle „um politische Hegemonie kämpfen und Gegenmacht organisieren.“30Aufgabe sei der „langfristige Aufbau außerstaatlicher, gesellschaftlicher Gegenmacht in der Verbindung von revolutionärer Organisierung und sozialen Bewegungen.“31 Die Gegenmacht solle aufgebaut werden „für ein linkes Hegemonieprojekt mit Vergesellschaftung als zentraler Achse.“32 Ob die iL aber von der Hegemonie zur Herrschaft der Unterdrückten übergehen möchte, bleibt hier ebenso unklar wie die Frage, in welchem Verhältnis die „außerstaatliche“ Gegenmacht zu einem eigenen Staat stehen würde, der „Vergesellschaftung“ umsetzt. In der politischen Praxis dieses Gegenmachtansatzes geht es eher darum, Mehrheiten für Vergesellschaftungen unter kapitalistischen Bedingungen zu organisieren, wie sich etwa bei den von der iL beeinflussten Initiativen „DW Enteignen“ oder „RWE enteignen“ zeigt.
Was sich bei den Zielsetzungen schon vage anhört, zeigt seine politische Zahnlosigkeit spätestens dann, wenn es zur Definition von Gegenmacht kommt: „Unter Gegenmacht verstehen wir Entscheidungen und Politiken der Herrschenden unterbrechen, aber auch eigene Lösungen durchzusetzen zu können.“33 Wollen wir nur „Politiken unterbrechen“ und „auch“ eigene Lösungen durchsetzen – oder wollen wir eine vollkommen andere Gesellschaft? Das heißt, den Herrschenden die Möglichkeit nehmen, überhaupt „Politik zu machen“, und auf unserer Seite nicht „auch“, sondern „nur“ die eigenen Lösungen der Unterdrückten, nämlich den Sozialismus in einer Revolution durchsetzen? Durch diese bewusste und interpretationsbedürftige Beliebigkeit positioniert sich die iL letztendlich innerhalb des Systems.
Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen?
Eine andere Form, der Machtfrage auszuweichen, sind Konzepte, welche versuchen, diese Frage einfach philosophisch wegzudiskutieren oder ihre Bedeutung zu leugnen. Sie wollen eine neue Welt in der alten aufzubauen, ohne sich lästige „Machtfragen“ zu stellen und weichen letztendlich der Frage nach der Zerschlagung des gegnerischen Staats aus.
Eine solche wilde Mischung aus Revisionismus, Anarchismus und Postmodernismus vertritt John Holloway (*1947). Dieser fasste seine Herangehensweise im Titel seines 2002 erschienenen Buchs „Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen“ zusammen. „Die einzige Form, um radikale Veränderungen zu erreichen, ist nicht die Eroberung der Macht, sondern die Auflösung der Macht“, heißt es bei Holloway in seinen breit in der Antiglobalisierungsbewegung der 2000er Jahre diskutierten „Zwölf Thesen über Anti-Macht.“34
Holloway geht davon aus, dass sowohl parlamentarische Veränderungen als auch die sozialistischen Aufbauprojekte in Russland oder China keine Befreiung mit sich gebracht hätten, weil sie auf einen proletarischen Staat gesetzt hätten: „Das Scheitern der Gesellschaftsveränderung durch den Staat hat mit dem Wesen des Staates selbst zu tun, damit, dass der Staat nicht einfach eine neutrale Institution ist, sondern eine spezifische Form von sozialem Verhältnis, die mit der Entwicklung des Kapitalismus aufkommt. Und dass er eine Form von sozialem Verhältnis ist, die auf dem Ausschluss der Menschen von der Macht basiert, die auf der Trennung und Fragmentierung der Menschen beruht.“
Holloway verwirrt hier in der Staatsfrage maximal. Zum einen ist der Staat eine Institution, die mit der ersten Teilung der Gesellschaft in verschiedene Klassen aufgetreten und damit viel älter ist als der Kapitalismus. Zugleich ist er gerade deshalb nicht von Ewigkeit und wird mit dem Erkämpfen der klassenlosen Gesellschaft abgeschafft werden.
Darüber hinaus ist es zwar richtig, dass der Staat nicht einfach „neutral“ ist, aber was bedeutet das? Er ist eben nicht einfach nur ein soziales Verhältnis, welches abstrakt „auf der Trennung der Menschen beruht“ – wie Holloway schreibt –, sondern er beruht auf konkreten Klassenverhältnissen, in welchem eine Klasse aufgrund ihrer Stellung zu den Produktionsverhältnissen den Staat zur Unterdrückung einer anderen Klasse nutzt. Darauf baut auch der Grundgedanke des sozialistischen Staatswesens auf: Ausschluss der alten Bourgeoisie von der Herrschaft, die sie nach der Revolution wieder an sich reißen will, und „Beherrschung“ dieser durch eine Diktatur des Proletariats, eine Diktatur der Mehrheit über eine Minderheit. Eben dieser Machtfrage weicht Holloway aus.
An dieser Stelle kann natürlich eingewendet werden, dass der Weg der Diktatur des Proletariats bisher nicht „funktioniert“ habe, da der sozialistische Staat in allen bisherigen Fällen zum Geburtsort einer neuen herrschenden Klasse geworden sei, anstatt dass eine immer breitere Einbeziehung der gesamten Arbeiter:innenklasse in die Ausübung der politischen Macht stattgefunden hätte. Diese Beschreibung ist zwar historisch zutreffend, die entscheidende Frage ist jedoch, welche Schlussfolgerung man daraus zieht: Die Macht weg definieren und die Machtfrage, die sich aufgrund des Widerstands der Bourgeoisie ohnehin stellen wird umgehen? Oder die bisherigen sozialistischen Aufbauversuche analysieren und kritisieren, Schlussfolgerungen ziehen und die Macht der Diktatur des Proletariats in Zukunft so nutzen, dass die Arbeiter:innenklasse es schafft, die Klassenverhältnisse abzubauen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Staat abstirbt. Sich diesen Schritten aber zu verweigern bedeutet in jedem Fall, die Machtverhältnisse zu verewigen.
Diese Lücke in der eigenen Theorie ist Holloway durchaus bewusst. Bei ihm wird die Machtfrage insofern „gelöst“, als dass er zwischen der „Macht des ,Tuns’“ einerseits und der „Befehlsmacht des Kapitals“ andererseits unterscheidet. Die Machtfrage wird also mit einem Taschenspielertrick wegdiskutiert: „Wir müssen deshalb über unseren Kampf nicht als Machtkampf denken, was bedeuten würde, deren Macht zu übernehmen, sondern als Kampf, unsere Macht des Tuns aufzubauen, die unvermeidlich eine soziale Macht ist.“35 Holloway möchte also nur „soziale Macht“, die jedoch so vage wie seine Vorstellung der Revolution bleibt. So schreibt er: „[Der] Weg des revolutionären Prozesses ist selbst als Frage zu verstehen, im Laufe dessen den Menschen nicht Antworten verkündet werden, sondern sie in einen Prozess der Selbstbestimmung einbezogen werden“36.
Wie soll das konkret aussehen? „Wenn wir morgen alle im Bett bleiben, wird der Kapitalismus aufhören zu existieren“, so Holloway. Der Kapitalismus werde nur „gemacht“ und man müsse darüber nachdenken, wie man aufhören könne, ihn zu „machen“. Bei Holloway verschwinden reale Machtstrukturen, die durch soziale Beziehungen realer Menschen gebildet werden, damit in einer gedanklichen Utopie, die an Reggae-Lieder wie „Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin“ erinnert.
Dieses utopische Element, welches faktisch das Aufstellen einer strategischen Ausrichtung ablehnt, zeigt sich abschließend in der von Holloway geprägten Aussage „Fragend gehen wir voran“.37
Wir haben tatsächlich keine Blaupause vor uns, keine Anleitung, der wir einfach nur folgen müssten, um den weltweiten Kommunismus zu errichten. Auch wenn es in der kommunistischen Bewegung immer wieder Tendenzen zu solchen dogmatisierenden Heilsvorstellungen gibt, haben diese mit einem dialektisch-materialistischen Herangehen nichts zu tun. Selbstverständlich gilt es, offene Fragen zu benennen, und sie im Laufe des eigenen Voranschreitens auch in der Praxis zu beantworten. Doch dies wie Holloway auf die Spitze zu treiben und gleich jegliche bisher gefundenen Antworten mit einem Federstreich beiseite zu wischen, bringt uns keinen Schritt weiter. Es theoretisiert die Verabsolutierung der Seite der Praxis im Hier und Jetzt und verneint die Möglichkeit, aus der Vergangenheit zu lernen, auszuwerten und aufbauend auf dieser Auswertung Schritte für die Zukunft festzulegen, diese praktisch zu gehen, die eigenen Erfahrungen wieder auszuwerten, zu theoretisieren usw.
Was als falsche Theorie eines Professors abgetan werden könnte, hat jedoch direkten Einfluss auf reale Bewegungen wie die Zapatistas in Mexiko und die PKK in Kurdistan – zwei trotz verschiedener Formwechsel einflussreichen linken Organisationen.
Das Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, dt. Zapatistische Armee der nationalen Befreiung) hat 1994 einen bewaffneten Kampf gegen den mexikanischen Staat begonnen. Nach einem kurzzeitigen Aufstand in verschiedenen mexikanischen Städten und der Ankündigung, mit 3000 Guerilleros auf Mexiko-Stadt zu marschieren, wurden die Zapatistas in den Dschungel gedrängt. Nach dem Rückzug erklärte ihr De-Ffacto-Anführer Subcomandante Marcos: „Die Übernahme der Macht? Nein, nur etwas weitaus schwierigeres: eine neue Welt.“ In starkem Kontrast zu dieser theoretischen Ablehnung der Macht und des Staates haben die Zapatistas in blutigen Kämpfen ein Territorium erobert, in dem sie ein politisches System nach ihren Vorstellungen geschaffen haben und bis heute auf Waffen gestützt verteidigen – also de facto staatliche Strukturen. Nach einem taktischen Rückzug Ende 2023, in welchem sie ihre Strukturen weiter dezentralisiert haben, bemühen sie sich weiterhin darum, die eigenen Errungenschaften in einer Art langfristigen Koexistenz mit dem mexikanischen Staat zu verteidigen. Dabei zeigt sich jedoch, dass dies immer schwieriger wird. Auch in Chiapas wütet der mexikanische Drogenkrieg und kann nicht aus eigener Kraft zurückgedrängt werden, sondern hängt letztlich mit einer gesamtnationalen sozialistischen Lösung zusammen.38
Auch der kurdische Revolutionär Abdullah Öcalan (*1949) wurde von Holloway sowie dem Anarchisten Murray Bookchin (1921-2006)39 bei seiner Konzeption des „demokratischen Konföderalismus“ inspiriert40. Diese beschreibt die Strategie der PKK bzw. ihres Dachverbands KCK, an welchen auch die in Nordostsyrien (Rojava) kämpfende PYD angegliedert ist. Öcalan vertritt in seinen Schriften die Position, dass es in der Geschichte der „Zivilisation“ immer schon einen Kampf zwischen der „staatlichen Herrschaft“ und der „demokratischen Gesellschaft“ gegeben habe. Es gelte eine eigene „demokratische Gesellschaft“ jenseits des Staates aufzubauen. Diese Vorstellung wurzelt stark in der spezifischen Geschichte der westasiatischen Gesellschaften mit ihrer mehrtausendjährigen Existenz von Stämmen, Dorfgemeinschaften usw. Tatsächlich findet man an der gesellschaftlichen Basis dort sehr viel Kontinuität, die sich gegen alle Wechsel von Kolonialherren, Regierungen usw. behauptet hat. Dass hier ein anderes Geschichtsbild entsteht,als in Europa, wo die Lage der arbeitenden Bevölkerung sich mit jeder sozialökonomischen Formation dramatisch verändert hat, mag nicht verwunderlich sein (ebensowenig wie bei den Kleinbäuer:innen in Chiapas).
Doch auch für die kurdische Selbstverwaltung in Rojava gilt: Was hier faktisch stattgefunden hat, war eine Machtergreifung und der Aufbau eines neuen Staates mit ratsähnlichen Strukturen, einer bewaffneten Armee, Polizeieinheiten usw. – ob Öcalan das so nennen möchte oder nicht.
In der Praxis haben also sowohl die Zapatistas als auch die KCK die Welt zumindest in ihrer Region tatsächlich verändert – jedoch nicht durch das Wegdefinieren der Macht- und Staatsfrage, sondern indem sie die Macht übernommen und staatliche Strukturen aufgebaut haben.
***
Die Ideen von Negri/Hardt, Bookchin, Holloway oder Öcalan finden ihre Widerspiegelung auch in verschiedenen Strömungen und Organisationen in Deutschland, welche solche Ansätze mit dem Label Gegenmacht umschreiben. So wird der Begriff z. B. in der Klimabewegung der Begriff demonstrativ genutzt. Deren radikaler Flügel bringt den falschen Ansatz mit all seinen politischen Konsequenzen denkbar offen auf den Punkt. Das Kollektiv Ausgeco2hlt schreibt etwa: „Unsere Vision ist eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Herrschaft. Herrschaft verstehen wir dabei als Macht über Menschen, wohingegen der Aufbau von Gegenmacht für uns den Aufbau von individueller und organisatorischer Handlungsfähigkeit im Sinne von Macht zu Handlungen [Macht des Tuns, siehe Holloway; anm. der Autoren] bedeutet. (…) Wir teilen nicht das Bild einer plötzlichen, punktuellen und schlagartigen, alles verändernden Revolution, durch die und nach der alles gut wird. Dennoch wird es auch größere Umbrüche auf dem Weg zum guten Leben für alle geben müssen. Wir sehen die Überwindung aller Herrschaftsverhältnisse als einen Prozess, durch den und in dem sich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, unsere Verbindungen zu ‚Natur‘ und Umwelt, unsere Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft langfristig und tiefgehend verändern. Diesen Prozess begreifen wir als den Aufbau von Gegenmacht, der unsere Macht zu einem selbstbestimmten Leben vergrößert und staatliche und wirtschaftliche Macht über unsere Leben eindämmt. Diese Gegenmacht versuchen wir im Rheinischen Braunkohlerevier aufzubauen, das für uns ein Kristallisationsort verschiedener Herrschaftsachsen ist (…), die wir als Interventionspunkte im Kampf gegen Ungerechtigkeit und als Anknüpfungspunkte für den Aufbau einer neuen Gesellschaft nutzen.“41
In diesem Zitat zeigt sich deutlich die Verwirrung, welche durch die oben genannten Theoretiker:innen in der deutschen Bewegung aber auch anderswo gestiftet wird. Denn die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution wird faktisch geleugnet und in ein vages Stufenmodell aufgelöst. Damit wird die Frage von Macht und Herrschaft von der ökonomischen Basis, dem Kapitalismus, gelöst. Wenn die Verfügungsgewalt des Kapitals über die Produktionsmittel jedoch unangetastet bleibt, ist eine Befreiung unmöglich.
Gleichzeitig wird die eigene Praxis auf den Aufbau von Gegenmachtprojekten reduziert. Dadurch wird keine Strategie für die Befreiung der Unterdrückten entwickelt, sondern sich der Illusion hingegeben, man könne versuchen, die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse um einen herum zu ignorieren. Dies funktioniert nur so lange, bis man schließlich vom Staat platt gemacht wird, oder in eine langfristige Koexistenz mit ihm eintritt.Beides bedeutet jedoch, auf dem Weg zum Ziel einer herrschaftslosen Gesellschaft stecken zu bleiben und langfristig zurückzufallen.
Der Klassenstandpunkt wird dadurch aufgegeben und die Klasse durch diejenigen ersetzt, die sich in Bewegung setzen lassen. Damit können Proteste organisiert und größere Freiräume erkämpft werden, eine andere Gesellschaft jedoch nicht.
Gegenmacht als falsche Fährte in der revolutionären Bewegung
Nachdem wir verschiedene evolutionäre Gegenmachtauffassungen betrachtet haben (wobei einige bis in das revolutionäre Lager hineinwirken), wollen wir uns nun Kräften aus dem revolutionären und kommunistischen Lager zuwenden, die sich positiv auf diesen Begriff beziehen und unterschiedliche Konzepte dazu entwickelt haben.
Der Gegenmachtbegriff findet sich weder bei den klassischen kommunistischen Vordenker:innen, noch bei den kommunistischen Organisationen der 20er und 30er Jahre.42 In der revolutionären Bewegung taucht er prominent erst ab den 60er und 70er Jahre auf, und zwar vor allem im Zusammenhang mit den verschiedenen bewaffneten Stadtguerillaorganisationen. So erklärte die erste Generation der Roten Armee Fraktion: „Es ist notwendig, die Politik der alten Linken zu kritisieren, denn wie sie auf der einen Seite exemplarisch zeigt, daß es in der Epoche des imperialistischen Weltsystems absolut unmöglich ist, proletarische Politik zu machen, ohne sich zu bewaffnen, Führung des Klassenkampfs zu sein, ohne Offensivpositionen der Klasse zu erobern, die Subjektivität der Klasse zu konstituieren, ohne die proletarische Gegenmacht aufzubauen – daß es unmöglich ist, das Kapital zu bekämpfen, ohne sein Antagonismus zu sein.“43 Die grundsätzliche Abgrenzung der RAF zur „Alten Linken“ – das heißt beispielsweise zur revisionistisch erstarrten KPD, die später zur DKP wurde, und deren Legalismus war politisch wichtig. Dabei schoss sie jedoch „links“ über das Ziel hinaus. So warf sie beispielsweise der Dritten Internationale „Verrat“ sowie der KPD die „Unfähigkeit“ vor, „zu einer an der proletarischen Revolution/Eroberung der politischen Macht durch bewaffneten Kampf orientierten Politik zu kommen, die im Proletariat Klassenidentität und revolutionäre Energie hätte entwickeln können“.44 Zwar war die KPD auf militärischem Gebiet tatsächlich in den 20er und 30er Jahren nicht stark genug für den bewaffneten Umsturz, die Begrenzung der Kritik auf ihre Militärpolitik ist jedoch einseitig. Vielmehr geht es doch damals wie heute um die Frage, wie es gelingt, alle Kampfformen so im Zusammenspiel einzusetzen, dass der Klassenkampf hin zu einer Revolution der Arbeiter:innen höher entwickelt wird.
Die RAF ersetzte jedoch den revolutionären Klassenkampf durch die Fokustheorie. Diese von lateinamerikanischen Revolutionären wie Che Guevara (1928-1967) und Carlos Marighella (1911-1969)45 geprägte Revolutionsstrategie geht davon aus, dass ein kleiner Kern (im spanischen „foco“) aus Revolutionär:innen durch bewaffnete Aktionen einen „Funken schlagen“ kann, der dann von den unterdrückten Massen, der „ausgedorrten Steppe“ aufgegriffen wird und diese zum revolutionären Aufstand anstachelt, da sie sehen, dass der Staat schwach ist und Aktionen gegen ihn möglich sind. Das Problem daran ist jedoch, dass sich auf solche „spontane Art“ eben kein dauerhaftes revolutionäres Klassenbewusstsein bildet. Somit tendiert diese Herangehensweise dazu, dass sich der foco in ein Duell mit dem Staat begibt. Dieses muss jedoch zu Ungunsten der Revolutionär:innen ausgehen, da es der revolutionären Seite zunächst an der bewussten Klasse fehlt, welche in den Kampf zieht. Auch die Frage des Vorliegens einer revolutionären Situation wird hier außer Acht gelassen. Bevor diese Niederlage eintritt, verengt der foco jedoch seine Sichtweise auf die Frage, wer das revolutionären Subjekt ist, immer weiter auf sich selbst. Dieser Prozess vollzog sich so auch bei der RAF, die im Laufe ihres Kampfs den Aufbau „proletarischer Gegenmacht“ immer stärker mit sich selbst identifizierte: „Solange die Massen nicht den Bruch mit dem Kapitalverhältnis, also dem Staat, vollzogen haben, sie Objekt des Kapitals sind, ihre Identität also vom Staat bestimmt, verstaatlicht ist, [ist es so,] daß sie den Bruch aber nur als bewußtes Subjekt des Prozesses des Aufbaus revolutionärer Gegenmacht vollziehen werden – das heißt: bewaffnet –, mobilisiert durch die Vermittlung der bewaffneten Aktion der Avantgarde, unserer Aktion, und zur Identität mit uns kommen werden: zu bewaffneter proletarischer Politik.“46In dieser Auffassung wird das revolutionäre Subjekt der Arbeiter:innenklasse zwar nicht komplett weg definiert, jedoch faktisch durch die Stadtguerilla als überzeugten Kern ersetzt, welche durch ihre eigene Existenz Gegenmacht verwirklicht sieht. Tatsächlich konnte jedoch eine weitgehende Isolation von der Klasse durch die Repression des Staats hergestellt werden.
Während im Reformismus auch jeder kleinste Widerstand einer Bewegung gegen das Kapital schon Gegenmacht ist, wird bei der RAF die bewaffnete Aktion zum einzigen Weg, wie Gegenmacht konstituiert wird – und zwar durch das kämpfende Individuum. Dabei zeigen sich auch die Einflüsse des Existenzialismus, einer philosophischen Strömung, welche in der Studierendenbewegung der 60er und 70er durch Intellektuelle wie Jean-Paul Sartre (1905-1980), Simone de Beauvoir (1908-1986) oder Albert Camus (1913-1960) einflussreich war. Der Existenzialismus geht davon aus, dass es keine abstrakte „menschliche Natur“ oder Vorherbestimmung gebe, sondern der Mensch frei seine eigenen Handlungen bestimmen müsse und sich dadurch selbst definiere. Eine materialistische Sichtweise, welche Produktions- und Klassenverhältnisse als Rahmen für Entscheidungsmöglichkeiten versteht, die selbst jedoch nicht einfach nur aufgrund des eigenen „Willens“ verändert werden können,47 fehlt bei dieser subjektiv-idealistischen Auffassung. Bei der RAF zeigten sich diese Einflüsse in der Form eines „militanten Existenzialismus“ (Camus: „Ich revoltiere, also sind wir“48), der letztendlich einem voluntaristisch-idealistischen Revolutionsverständnis entspringt. Dieses prägte die RAF während der gesamten Zeit ihrer Existenz trotz ihren revolutionären Enthusiasmus und Einsatzgeist für die Unterdrückten.
Positive Bezugspunkte zur Gegenmacht bestanden aber nicht nur bei der RAF. Ähnlich findet sich der Begriff auch bei dem stärker an den Autonomen orientierten Revolutionären Zorn, der 1975 – um einiges bescheidener als die RAF – schrieb: „Was wir wollen ist die Gegenmacht in kleinen lernen organisieren, die autonom in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen arbeiten, kämpfen, intervenieren, schützen, die Teil der politischen Massenarbeit sind.“49 Auch bei Stadtguerillagruppen in anderen Ländern wurde der Begriff der Gegenmacht genutzt, so etwa bei den Brigatte Rossi in Italien. Bei ihnen heißt es etwa: „Keine revolutionäre Bewegung, die um die Macht kämpft, kann dem Zusammenstoß begegnen, ohne in der Lage zu sein, zwei grundsätzliche Bedingungen zu schaffen: 1. sich mit der Macht auf allen Ebenen zu messen und zu zeigen, dass man in der Lage ist, bei diesem Niveau der Auseinandersetzungen zu überleben; 2. in den Fabriken und proletarischen Stadtteilen eine Gegenmacht entstehen zu lassen“.
Dies wurde später von ehemaligen Militanten der Bewegung als problematisch ausgewertet, wobei sie sich in ihrer Analyse nicht nur auf ihre eigene Bewegung begrenzten. So kritisierten Aktive der bewaffneten Bewegung in einer rückblickenden Analyse, „Gegenmacht“, sei „ein Begriff, der sich in allen geschichtlichen Erfahrungen als inkonsistent und kraftlos erwiesen hat und die Klasse in ein defensivistisches Verhalten gezogen hat, dessen Schicksal die Niederlage ist oder das in anderen Fällen vom Kompromiss zu Kompromiss geführt hat, zu Formen der Wiedergewinnung für den institutionalisierten Reformismus wie zum Beispiel der Weg der ZapatistInnen in Mexiko. Oder sie suchten nach neuen revolutionären Ansätzen (in Anbetracht der Abwege der sozialistischen Länder), gerieten aber schnell auf unsichere Pfade, wo der Eklektizismus, das Abenteurertum und der Konfusionismus sie schliesslich zur Kapitulation führte und diese war sehr wohl „total“.50
Gegenmacht durch Hegemonie in der politischen Widerstandsbewegung?
Die Diskussionen der RAF, der Brigatte Rossi und weiterer Stadtguerillagruppen beeinflussten trotz ihres Niedergangs weiterhin ernsthafte revolutionäre Kräfte, welche die Kerngedanken daraus zu einem politischen Konzept ausgebaut und weiterentwickelt haben. Einen jüngeren organisatorischen Ausdruck fand dies nach 1990 im deutschsprachigen Raum in der Schweiz. Hier schlossen sich mehrere Gruppierungen im Jahr 1992 zum Revolutionären Aufbau Schweiz (RAS)zusammen.51 Diese Organisation sowie spätere von ihr inspirierte Projekte in Deutschland sollten in der Folge zentrale Fragen des revolutionären Aufbauprozess in den imperialistischen Zentren aufwerfen – von der Frage des Aufbaukonzepts („Wie können wir Revolutionär:innen bilden, eine Organisation schaffen und mehr werden?“) über die Methoden der Massenarbeit („Wann und wie können wir den Sozialismus mit der Arbeiter:innenbewegung verbinden?“) bis zur Rolle der revolutionären Gewalt. Die dabei verfolgte Herangehensweise zum Aufbau einer revolutionären Organisation durch diese Strömung fand ebenfalls unter dem Motto des Aufbaus von Gegenmacht statt. Da der RAS eine Struktur im deutschsprachigen Raum ist, welche ihre Gedanken dazu verhältnismäßig ausführlich entwickelt, theoretisiert und schriftlich dargelegt hat, wollen wir uns dieses Beispiel anhand seiner Veröffentlichungen und eigenen Auswertungen exemplarisch anschauen. Gerade weil diese Genoss:innen und auch andere Kräfte, welche ähnliche Auffassungen vertreten, innerhalb der revolutionären und kommunistischen Bewegung immer wieder zu den in der Praxis am meisten vorantreibenden Kräften einer kämpferischen Straßenpraxis gehören, wollen wir eine solidarisch-kritische Auseinandersetzung zur Strategie und Taktik im Klassenkampf führen, um somit einen Beitrag zur Klärung von zentralen Fragen der Bewegung zu leisten.
Überlebenstaktik und „Primat der Praxis“
Die Ausgangsposition zur Zeit seiner Gründung Anfang der 90er Jahre fasst der RAS so zusammen: „Nach der umfassenden Krise der revolutionären Linken in den Metropolen, des kontinuierlichen Verlustes des revolutionären Charakters der Befreiungskämpfe im Trikont und insbesondere auch nach dem Ende des Revisionismus 1989 ging es zuallererst darum, an der kommunistischen Alternative zum Kapitalismus festzuhalten“. Es sei zudem notwendig gewesen, auf Basis der bisherigen Erfahrungen die neue geschichtliche Etappe zu erkennen, nämlich dass „der Übergang vom Imperialismus zum Sozialismus (…) eine Frage von Jahrhunderten, Generationen und mehreren Anläufen sein [wird], nicht zuletzt wegen der enormen Zunahme an gesellschaftlicher Komplexität.“ Dadurch falle auf der subjektiven Seite der „Kontinuität, sprich dem politischen Reproduktionsprozess“, die „entscheidende Bedeutung“ zu.
Auf Basis dieser Einschätzung einer umfassenden strategischen Defensiveder revolutionären Seite entwickelte die Organisation ein Vorgehen, welche man als „Überlebens-Taktik“bezeichnen könnte. Es gäbe nun die Notwendigkeit eines schrittweisen organisierten Aufbauprozesses, um die neu entstehenden Keime revolutionärem Bewusstseins zu sammeln: „An der Fähigkeit zur Reproduktion der revolutionären Kräfte misst sich gegenwärtig der Erfolg oder Misserfolg des revolutionären Prozesses.“52
Zur Frage des Parteiaufbaus erklärte der RAS, diese als Organisation nicht selbst und direkt angehen zu wollen. Zwar ging man grundsätzlich davon aus, dass die proletarische Revolution „nur unter der Führung der kommunistischen Partei“ erfolgreich durchgeführt werden könne. Man selbst verstehe sich jedoch nicht als eine „partei-aufbauende Struktur“, sondern als eine „Massenorganisation, die mit ihrer Theorie und Praxis mithilft, die Voraussetzungen zur Wiedergründung einer Kommunistischen Partei zu schaffen.“ Wie der weitere Weg in diesem Aufbauprozess aussehen sollte – darauf wollte man sich jedoch bewusst nicht festlegen.
Stattdessen wird in einer Antwort53 auf die Kritik einer trotzkistischen Splittergruppe das „Primat der Praxis“54 als eigene Herangehensweise herausgestellt: „Die Parteifrage ist für uns weniger eine theoretische als eine praktische Frage: Welche gesellschaftlichen Bedingungen müssen gegeben sein, dass ein Gründungsprozess einer Partei mehr ist als die Kopfgeburt einiger fähiger und gutwilliger GenossInnen? Welchen Charakter muss sie haben, um als führende Kraft eine relevante Anerkennung und Überlebenschance zu haben? Diese Fragen können nicht in einem theoretischen Diskurs gelöst werden.“55 Damit wurde zwar einem theoretischen Schematismus, welcher mit historischen Erfahrungen wie mit einem Kochrezept arbeiten will, ein Riegel vorgeschoben. Doch zugleich kam darin eine gewisse Geringschätzung der theoretischen Untersuchung vergangener Aufbaukonzepte und Parteiaufbauversuche sowie der Theoretisierung der heutigen beschränkten revolutionären Aufbauerfahrungen (inklusive der eigenen) zum Ausdruck.
Auch wurde die Vereinheitlichung innerhalb der kommunistischen Bewegung und der eigenen Organisationen in die Zukunft verschoben.Man wolle „keine so strenge „Einheitsmeinung“ vertreten, wie das eine Partei tun müsste“. Man sehe darin sogar die eigeneStärke.56 Dringlicher als „theoretische[n] Fachdiskussionen“ etwa über den Sieg der Bürokratie in der Sowjetunion „erscheint es uns die Klasse in jenen wenigen gegebenen Kämpfen, zu begleiten, den Kampf anzuspornen und die Klasse überhaupt zum Kampf zu befähigen – wo dies möglich ist. Und besonders darum, ein minimales Bewusstsein darüber am Leben zu erhalten, dass der Kapitalismus nicht naturgegeben ist und die kommunistische Idee am Leben zu erhalten.“57
Damit wurde die theoretische Debatte zwar nicht verneint, jedoch de facto der praktischen Massenarbeit gegenübergestellt. In der richtigen Abgrenzung gegenüber einer rückwärtsgewandten und dogmatischen Diskussionskultur über theoretische Fragen sowie der Negativerfahrung von Theoriezirkeln der Vergangenheit, die sich als „die Partei“ verstanden hatten, schlug man mit einer Überbetonung des „Primats der Praxis“ im Verhältnis von Theorie und Praxis nun ins Gegenteil um.
Man theoretisierte damit letztendlich eine Tendenz zum Spontaneismusim revolutionären Aufbauprozess sowie ein fast schon gesetzmäßiges langsames Wachstum. Es wird eine langandauernde Phase vorhergesagt, in der es im wesentlichen um die Reproduktion der eigenen Kräfte gehe. Deshalb solle man möglichst „breit“ Genoss:innen sammeln, um sich nicht in falscher Abgrenzung zu verrennen, und somit die Organisation als revolutionäre Sammlungsbewegungunter der Hegemonie des Kommunismus in seiner allgemeinsten Form begründen. Um bestimmte Schritte in Fragen des Parteiaufbaus sowie der Beantwortung offener theoretischer Fragen zu gehen benötige es letztendlich eine Veränderung der objektiven Seite der Arbeiter:innenbewegung, also einer proletarischen Massenbewegung. Dadurch überlässt man die Aufgabe, den Aufbauprozess gezielt anzuleiten und höher zu entwickeln tendenziell der Spontanität der einzelnen „Praxen“ sowie dem Warten auf die Veränderung der objektiven Bedingungen.
Die kommunistische Bewegung war nach 1990 jedoch nicht von der Aufgabe der theoretischen Arbeit befreit. Ebenso wie sich Kämpfer:innen nicht im luftleeren Raum entwickeln können, können sich auch Theoretiker:innen der Revolution nicht entwickeln, ohne sich praktisch und als integrierter Teil eines Aufbauprozesses mit theoretischer Arbeit zu beschäftigen. Vor der kommunistischen Bewegung nach 1990 standen eine Reihe an zentralen offenen theoretischen Fragen: Vom Scheitern des Sozialismus in der Sowjetunion über die Frage der marxistischen Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung im imperialistischen Zentrum hin zur Frage einer modernen Imperialismus- und Klassenanalyse. Aspekte dieser Fragen wurden in der Folge immer wieder in der eigenen Zeitung Aufbau sowie weiteren Publikationen wie der Subversion aufgeworfen. Mit ausführlichen Publikationen hielt sich die Organisation jedoch zurück. Der Schwerpunkt sollte stattdessen der praktische „Aufbau revolutionärer Gegenmacht“ sein.
Gegenmacht und politische Widerstandsbewegung
Als zentrale Aufgabe setzt sich die Organisation in ihrer Politischen Plattform von 2007, die Perspektive der „Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat (…) über den Aufbau von revolutionärer Gegenmachtin der täglichen politischen Praxis sichtbar und fassbar“ zu machen.58
Daran anschließend formulierte der RAS präzise eine nicht-ökonomistische Verbindung von Tageskampf und Revolution: „Der proletarische Klassenstandpunkt bildet die Grundlage kommunistischer Politik, die von konkreten Tageskämpfen der Klasse oder gesellschaftlichen Brennpunkten ausgeht, deren über die Tagesaktualität hinausgehenden fortschrittlichen Inhalte herausarbeitet und in den Kampf für den Kommunismus einbettet.“59
Welche Rolle dabei jedoch nun die Gegenmacht spielen sollte und was darunter verstanden wird, blieb im eigenen Grundlagendokument offen. 2010 beschrieb die Organisation in ihrer Zeitung Aufbau: „Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen die Entwicklung und Umsetzung konkreter Formen von Gegenmacht, d.h. Handlungsweisen, welche den kapitalistischen Alltag mit seinen Unterdrückungsverhältnissen, Werten und Gesetzen durchbrechen.“60Dabei sei insbesondere der „Kampf auf der Straße (…) der zentrale Ort, wo die verschiedenen Stränge des Klassenkampfes zusammen kommen“61 und deshalb zentrale Achse der Praxis des RAS. Eine Stärkung in diesem Bereich würde auch Positionen an anderen Orten des Klassenkampfes wie Betrieb, Uni oder Schulen, stärken. Letztlich wird somit gerade die militante Auseinandersetzung auf der Straße als Hebel gesehen, nicht nur um Klassenbewusstsein zu schaffen, sondern auch um den Klassenkampf an weiteren Orten, wo die Klasse lebt und arbeitet, zu verbreitern.
Klar ist: Um führend zu sein, müssen Kommunist:innen alle Kampf- und Organisationsformen meistern. Sie dürfen der Arbeiter:innenklasse nicht hinterher traben, weder inhaltlich noch praktisch. Dort wo diese massenhaft unter Tageslosungen auf die Straße geht, gilt es Formen zu finden, wie Hunderte und Tausende organisiert und dem Sozialismus im weiteren Kampf nahegebracht werden können. Auch dort, wo sich Teile der Klasse in den direkten Kampf mit der Polizei begeben, etwa bei der Blockade von faschistischen Aufmärschen, im direkten Kampf gegen Faschist:innen im Viertel, Arbeiter:innenstreiks oder im Kampf für internationale Solidarität müssen Kommunist:innen führend und vorantreibend sein, ja selber auch diese Kämpfe initiieren. Dafür müssen sie selbst nicht nur willens, sondern auch praktisch fähig sein, diesen Kampf zu führen und müssen dementsprechend selber zuvor darin Erfahrung sammeln. Den Kampf um die Straße jedoch zu dem „zentralen Ort“ zu deklarieren überbetont dieses Kampfmittel und diesen „Ort“, da somit die Ausübung revolutionärer Gewalt auf Demonstrationen oder ähnlichem zum einzigen Ankerpunkt der eigenen Klassenkampfpraxis wird – die aber viel breiter und tiefer sein muss. Hier zeigen sich zentrale theoretische Elemente der Fokustheorie, die versucht werden in diesem Konzept zu verarbeiten.
Hintergrund dessen ist auch, dass der eigene Bezugspunkt zwar theoretisch gesprochen immer noch die gesamte Arbeiter:innenklasse bleibt, praktisch spielt jedoch die „politische Widerstandsbewegung“die zentrale Rolle und wird somit zum Subjektdieses Gegenmachtkonzepts.
Grundlage der eigenen Politik ist dabei die Analyse, dass das politische Bewusstsein heute in zwei wichtigen Sektoren geschaffen werden müsse, nämlich der Arbeiter:innenbewegung und der in den 70er Jahren entstandenen politischen Widerstandsbewegung – wobei letztere die wichtigste Rolle in der aktuellen Aufbauphase einnehme. Historisch sei der Betrieb der zentrale Ort gewesen, in dem Bewusstsein geschaffen worden sei. Dieser habe nach wie vor strategische Bedeutung. Bei der Arbeit in der Arbeiter:innenbewegung wolle man in Abgrenzung zu den K-Gruppen („Parteien mit doktrinärer marxistisch-leninistischer Ideologie“)62 jedoch keine eigenen Mitglieder in die Betriebe schicken. Ganz nach dem „Primat der Praxis“ wolle man betrieblich vor allem von außen unterstützen: „Wir intervenieren hauptsächlich dort, wo sich schon etwas bewegt“63. Hier zeigt sich auch eine Parallelität zum Konzept der interventionistischen Linken, welche ebenfalls ihre politische Praxis auf den Zyklus politischer Bewegungen orientiert.
Eine Besonderheit dieses Gegenmachtkonzepts ist also die zentrale Rolle der politischen Widerstandsbewegung – und dessen Ausdruck auf der Straße – im eigenen Aufbauprozess. Der Begriff der politischen Widerstandsbewegung, der heute breiten Einzug in das Vokabular der marxistischen Linken gehalten hat, wurde unter anderem vom RAS popularisiert. Demnach seien aufgrund der zunehmenden Ausdifferenzierung der Arbeiter:innenklasse und den konkreten Kämpfen seit der 1968er Bewegung eine Reihe an eigenständigen Teilbereichskämpfen entstanden, welche sich gegen einzelne Symptome des Kapitalismus/Imperialismus wenden: Die Ökologie-Bewegung, die antimilitaristische- und Friedensbewegung, die antifaschistische Bewegung, Antirepressionsbewegungen, die neue Frauenbewegung usw. Diese Bewegungen behandeln sowohl Lebensbedingungen des Proletariats als auch des Kleinbürger:innentums und seien somit meist klassenübergreifend. In diesen Teilbereichskämpfen entstünden politisches Bewusstsein und politische Kollektive innerhalb der Bewegung – und zwar öfter als über den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.64
Tatsächlich ist aufgrund der Schwäche der kommunistischen Bewegung nach 1945 die Trennung zwischen ökonomischem und politischem Kampf innerhalb der Betriebe immer stärker geworden und der Einfluss revolutionärer Positionen auf (ältere) Arbeiter:innen innerhalb der Betriebe wurde immer geringer.
Dagegen waren diese revolutionären Einflüsse in den seit den 1970ern entstandenen und viel von jungen Menschen geprägten „neuen sozialen Bewegungen“ durch die Vorbilder der chinesischen Kulturrevolution, des vietnamesischen Widerstands und des Guevarismus aus Lateinamerika stärker. Zugleich mangelte es hier (und bis heute) an einer starken kommunistischen Partei und somit standen die verschiedenen klassenübergreifenden „Teilbereichsbewegungen“ im wesentlichen unter bürgerlicher Führung. Das heißt ihre Existenz als von der Arbeiter:innenbewegung getrenntes Phänomen rührte nicht nur von objektiven (wo die Ausdifferenzierung der Klasse sicherlich ihren Anteil hatte), sondern insbesondere von subjektiven Faktoren her.
Doch gerade dieser Aspekt wird vom RAS nicht thematisiert. Im Gegenteil macht er aus der „Not eine Tugend“ und verewigt die Existenz der politischen Widerstandsbewegung in der eigenen Herangehensweise. Es wird versucht, irgendwie mit der Logik der politischen Widerstandsbewegung einen Umgang zu finden. Es wird davon ausgegangen, dass, wenn einmal anhand eines Themas politisches Bewusstsein entstanden sei, es bei einem Teil der politischen Widerstandsbewegung auch „zur Politisierung über dieses Thema hinaus“ und zur „Verknüpfung verschiedener Gebiete des Widerstands“ käme. Damit einher gehe eine größere Selbstverständlichkeit, das „staatliche Gewaltmonopol zu durchbrechen“, wodurch es zu einer „authentischen, antikapitalistischen Stossrichtung von Teilen der PWB“ käme. Der RAS will hier zum „Orientierungspunkt für eine Klassenposition und eine kommunistische Perspektive innerhalb der PWB“ werden.Jedoch könnten weder die PWB noch die Bewegung in den Betrieben von sich aus eine kohärente Theorie und Strategie entwickeln. Man sehe es deshalb als die eigene Aufgabe, „die Verbindung zwischen Kampf in der PWB und Arbeitskämpfen in Form und Inhalt zu stärken“. Diese aus der Phase einer umfassenden Defensive geborene Aufbaustrategie kann damit wohlwollend als eine Art „Umweg“hin zur Klasse bezeichnet werden. Der RAS stellt jedoch fest, dass fast alle eigenen Genossinnen „über die PWB zu uns stiessen und stossen“ und schlussfolgert daraus: „Die PWB ist also nach wie vor unser wichtigstes Agitations- und Kampffeld.“
Zusammengefasst setzt sich die Organisation also als Hauptziel der eigenen Arbeit, selbst eine Hegemonie in der politischen Widerstandsbewegungzu erringen. Schwerpunkt der eigenen Verankerungsarbeit ist also nicht die Arbeiter:innenklasse als ganze, sondern die bereits in Bewegung geratene klassenübergreifende PWB und die Stärkung dieser. Geschehen soll die Organisierung mit einer „differenzierten Organisationsstruktur“, die der „konkreten Entwicklung des Klassenbewusstseins“65gerecht werde: Für die verschiedenen Teilbereiche („Klassenkampf“, „Antifa“, „Frauenkampf“ usw.) werden eigene Strukturen geschaffen, um in den jeweiligen politischen Widerstandsbewegungen einen kommunistischen Pol aufzubauen. Zusammengeführt werden sollen diese Kämpfe dann durch die revolutionäre Organisation selbst.
Mit dieser „Teilbereichsorganisierung“ bricht die RAS bewusst mit der bisherigen Organisierungsweise kommunistischer Organisationen, die sich fundamental nach den Orten, an denen die Klasse lebt und arbeitet, strukturiert – sprich: Durch Straßen- und Betriebszellen, Zellen in den Schulen und Universitäten. Dies ist auch insofern konsequent, da sie davon ausgeht, dass die PWB die Hauptquelle der „Reproduktion der revolutionären Kräfte“ sei und die Straße als Hauptaktionsfeld der PWB die „zentrale Achse“ der eigenen Praxis.
Die strategischen Probleme des Gegenmachtkonzepts
Das hier knapp dargestellte Gegenmachtkonzept möchte verschiedene Fallstricke der bisherigen kommunistischen Erfahrungen vermeiden und zugleich eine aktuelle Antwort auf neue Entwicklungen geben, schlägt dabei jedoch in eine falsche Richtung um und birgt langfristig die Gefahr, in einer Sackgasse zu landen.
Diese besteht im wesentlichen darin, dass der Aufbau einer klassenkämpferischen Arbeiter:innenbewegung und einer kommunistischen Partei und damit der Kampf um die Hegemonie in der Arbeiter:innenklasse durch den Kampf um die Hegemonie in der politischen Widerstandsbewegung ersetzt wird. Zwar gibt es bei diesem Gegenmachtkonzept immer wieder einen klaren Klassenbezug, doch der „Umweg“ über die politische Widerstandsbewegung bringt es letztendlich mit sich, die Arbeiter:innenklasse langfristig durch die PWB als revolutionäres Subjekt zu ersetzen. Diese Problematik zeigt sich in mehreren Facetten.
Professionalisierung der PWB statt systematischer Aufbau einer klassenkämpferischen Arbeiter:innenbewegung
Die Arbeiter:innenklasse hat sich seit den 70er Jahren stark ausdifferenziert. Das führt dazu, dass diese sich in teilweise sehr unterschiedlichen „Lebensweisen“ bewegt, die Frage der eigenen „Individualität“ und „Identität“ mehr in den Vordergrund rückt und die verschiedenen Widersprüche des Imperialismus/Kapitalismus unterschiedlich auf verschiedene Teile der Klasse wirken. Dies hat auch zur Verbreiterung von Teilbereichskämpfen geführt und dazu, dass das Gefühl, „eine Klasse“ mit gemeinsamen Interessen zu sein, erst wieder bewusst hergestellt werden muss. Auf diese objektive Realität der Ausdifferenzierung der Klasse sowie den ideologischen Einfluss des Postmodernismus wird jedoch im Gegenmachtkonzept damit geantwortet, die Arbeit der politischen Widerstandsbewegung nach links zu ziehen und zu systematisieren. Es wird versucht, mit einer Vertiefung der Teilbereichskämpfe zu antworten, anstatt langfristig die politische Tendenz zurückzudrängen, sich eben in Teilbereichskämpfen zu verlieren.
Dadurch wird der notwendige Prozess, in der Praxis einen Weg zu finden, wie kommunistische Massenarbeit stattfinden kann, wie ökonomische und politische Kämpfe im Betrieb, im Stadtteil, in der Uni und in der Schule „in den Kampf um den Kommunismus eingebettet“ werden können, nur in die Zukunft verschoben und nicht gelöst.
Ja, es ist richtig, dass die Reproduktion einer Organisation aus der direkten Massenarbeit schwierig ist – jedoch ist es nicht nur eine strategische Notwendigkeit, sondern es gibt durchaus praktische Beispiele, die zeigen, dass dies möglich ist, wenn diese Arbeit nicht nur ökonomische, sondern auch politische Kämpfe umfasst, eine intensive Beschäftigung mit den Potenzialen unserer Klasse stattfindet und sie in ein breites Netzwerk aus marxistischer politischer Bildung und sozialistischer lebendiger Kultur eingebettet sind.
Das bedeutet nicht, grundsätzlich die gezielte Arbeit zu konkreten Themen abzulehnen. Auch die historische KPD hat beispielsweise immer wieder Organisationen für bestimmte „Teilkämpfe“ geschaffen wie die antifaschistische Organisation Kampfbund gegen den Faschismus, die antiimperialistische Struktur Liga gegen Imperialismus und koloniale Unterdrückung, die Hilfsorganisation Internationale Arbeiterhilfe, die internationalistische Organisation Bund der Freunde der Sowjetunion, die Antirepressionsorganisation Rote Hilfe Deutschlandund viele weitere. Und doch hat sie dabei die Aufgabe der strategischen Verankerung an den Orten, wo die Klasse lebt und arbeitet, nicht aufgegeben, sondern sie war das Fundament. Es ist deshalb auch richtig, an den Kämpfen der politischen Widerstandsbewegung teilzunehmen und sie zu beeinflussen (vor allem weil auch bestimmte Teile unserer Klasse daran teilnehmen), jedoch immer eingewebt in den konkreten Prozess des Parteiaufbaus, der mit dem Wiederaufbau einer klassenkämpferischen Arbeiter:innenbewegung und Kommunistischen Partei verbunden sein muss. Es ist gerade eine starke in der Klasse verankerte Partei, welche die Kämpfe um bestimmte Teillosungen erfolgreich führen kann.
Begrenzung bei der Ausbildung kommunistischer Kader:innen
Die Konzentration auf die politische Widerstandsbewegung hat zudem größeren Einfluss auf die Art und den Inhalt der Ausbildung der eigenen Kader:innen. Es besteht die Gefahr, die Kampfformen der politischen Widerstandsbewegung, bei denen vor allem der „Kampf auf der Straße“ im Zentrum steht, zu verabsolutieren und die Kader:innenentwicklung zu sehr darauf zu begrenzen. Die Anwendung revolutionärer Gewalt muss – abgeleitet aus den konkreten Bedingungen – richtigerweise ein integrierter Teil des Aufbaus sein, sodass sich Revolutionär:innen darin schulen können und kann nicht auf eine spätere Etappe verschoben werden. Es ist jedoch zu einseitig, die politische Praxis so auf diesen Bereich zu konzentrieren, dass militantes Klassenbewusstsein allein in der direkten (individuellen) Konfrontation mit Polizei auf der Straße geformt werden soll. Kommunistische Militanz muss natürlich diesen Aspekt umfassen, und es ist richtig, ihn in den imperialistischen Zentren unter Bedingungen des Legalismus auch klar zu benennen. Und doch gibt es noch viele weitere Aspekte, welche für die Ausbildung eines allseitigen Klassenbewusstseins in einem revolutionären Aufbauprozess notwendig sind, sei es die direkte Konfrontation mit dem eigenen Chef im wilden Streik, die Unterordnung von Beziehung, Wohnort und Beruf unter die Politik, um den Aufgaben des Aufbauprozesses nachzukommen, die kontinuierliche Disziplin in der täglichen Agitation- und Propaganda, die gezielte Arbeit am Geschlechtsbewusstsein usw.
Dabei stehenzubleiben, die eigenen Kräfte vor allem innerhalb der politischen Widerstandsbewegung heranzuziehen und zu organisieren, führt zudem dazu, dass eine notwendige allseitige Entwicklung der eigenen Genoss:innen begrenzt wird. Diese erlernen zwar „aktivistische Fähigkeiten“ für einen Bereich, doch das Erlernen der Organisierung von allseitigen Kämpfen in den Orten, an denen die Klasse lebt und arbeitet, unterbleibt weitestgehend – und damit auch die Erfahrung etwa im eigenen Betrieb, im Stadtteil oder in der Schule zu kämpfen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Arbeitsteilung in einer kommunistischen Organisation auch auf ideologischem Gebiet zwischen den verschiedenen Teilbereichen verläuft und es somit den Genoss:innen schwerfällt, zu allseitigen Einschätzungen der Gesamtlage zu kommen. Mit der Zuspitzung der Widersprüche verlieren Teilbereichsbewegungen zudem an Anziehungskraft, da zumindest den politisch interessierten Teilen der Klasse und des Kleinbürger:innentums immer deutlicher wird, wie alle Fragen miteinander zusammenhängen und dass sie nur im Zusammenhang miteinander gelöst werden können.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die Ausbildung und Heranziehung der eigenen Genoss:innen unter den Bedingungen einer politischen Widerstandsbewegung stattfindet, welche vielfach massenfeindlich, basisdemokratisch, postmodern und antikommunistisch eingestellt ist. Hier besteht die Gefahr, dass die eigenen Genoss:innen vor allem Szenediskussionen führen (und zum Teil auch negativ von diesen beeinflusst werden), die jedoch in der Klasse in der Breite gar nicht vorherrschend sein müssen. Damit wird der spätere „Sprung in die Breite der Klasse“ noch mehr erschwert.
Zuletzt wird das gesellschaftliche Potenzial, aus dem man für die Schaffung eines revolutionären Kerns einer zukünftigen Partei schöpfen möchte, auf die politische Widerstandsbewegung begrenzt. Dabei umfasst der fortgeschrittenste Teil der Klasse – diejenigen, die allseitig interessiert sind, das System hinterfragen und bereit sind aktiv zu werden – weitaus mehr Menschen als die politische Widerstandsbewegung. Diese gigantischen Potenziale in der Klasse, die von einer erfolgreichen kommunistischen Massenarbeit geweckt werden müssen, bleiben somit ungenutzt.
Das „Primat der Praxis“ unterbetont die Aufgaben der kommunistischen Theorie und Strategiebildung
Kommunistische Kräfte haben in der Vergangenheit immer wieder dazu tendiert, schematisch historische Erfahrungen als Kochrezepte anwenden zu wollen, anstatt eine konkrete Analyse der konkreten Situation zu tätigen. Dies führte sowohl zu verfrühten Spaltungen als auch zum Abgleiten in Theoriezirkel. Die Überbetonung des „Primat der Praxis“ im Gegenmachtkonzept verstärkt jedoch eine Unterbetonung und spontaneistische Herangehensweise in der Theoriebildung und strategischen Führung.
Ideologisch werden viele Fragen in die Zukunft der proletarischen Massenbewegung verschoben, obwohl sie schon heute angegangen und in der Praxis überprüft werden könnten, um anschließend auf einem höheren Niveau theoretisch verarbeitet zu werden. Man könnte auch sagen, dass es ohne sie die notwendige Kontinuität nicht geben kann. Es gilt also eine Einheit von Theorie und Praxis zu schaffen, die sich gegenseitig bedingt.
Auch die Betonung darauf, vor allem dort zu sein „wo sich etwas bewegt“, führt dazu, die Aufgaben der strategischen Führung des eigenen Aufbauprozesses stark den Schwankungen der PWB und ihrer Teilkämpfe unterzuordnen, was einem ebenfalls das erschwert, was man als revolutionäre Bewegung erreichen muss, nämlich eine langfristige Kontinuität zu schaffen.
Gegenmacht ohne Partei?
Die beschriebene Herangehensweise des RAS ist in abgewandelter Form auch bei einer Reihe von Strukturen in Deutschland zu finden. Darunter finden sich zum Beispiel einige revolutionäre Organisationen, die sich in der Plattform Perspektive Kommunismus (PK)zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel ist laut Selbstverständnis „eine Organisation, die auf ideologischer, kultureller und politischer Ebene eine reale Gegenmacht zur Macht von Staat und Kapital aufbaut.“ Ein offizielles Grundlagendokument, wie Gegenmacht darin bzw. dadurch aufgebaut werden soll und was darunter zu verstehen ist, gibt es von PK jedoch nicht.
Es benötige in jedem Fall eine „bundesweite revolutionäre Organisation“66, der revolutionäre Aufbauprozess müsse jedoch genauso „Organisierungen etwa auf sozialer, kultureller, gewerkschaftlicher oder betrieblicher Ebene umfassen. Ebenso wie solche, die hauptsächlich in einem einzelnen politischen Widerstandsfeld aktiv sind, etwa dem Kampf um Klimagerechtigkeit, für Frauenbefreiung oder dem antimilitaristischen oder antifaschistischen Kampf.“ Gerade die Arbeit in diesen „Teilbereichen“ der PWB macht die politische Praxis von PK stark aus.
Einen etwas anderen Schwerpunkt bezüglich des Aufbaus von Gegenmacht benennt der Rote Aufbau Hamburg, eine der Strukturen von Perspektive Kommunismus: „Uns geht es darum eine reelle Gegenmacht aufzubauen; sei es im Fußballverein, im Stadtteil, im Betrieb oder auf der Straße. Eine Alternative zu dem herrschenden System muss sichtbar werden und Menschen ansprechen, die noch nicht in der „Szene“ aktiv sind. Dafür brauchen wir verschiedenste kulturelle, politische und sportliche Angebote. Wir müssen mit unserer Klasse in Kontakt kommen und Vertrauen und Solidarität aufbauen.“
Etwas intensiver ausformuliert findet sich diese Auffassung auch bei dem in Berlin aktiven Bund der Kommunist:innen (BdK), welcher nicht Teil von Perspektive Kommunismus ist, jedoch ebenfalls den Gegenmachtbegriff aktiv nutzt. Dabei rückt er jedoch die Arbeiter:innenklasse als ganzes – und weniger die politische Widerstandsbewegung – in den Fokus. Der BDK betont, dass Gegenmacht „kein Ziel in sich selbst ist, sondern ein strategisches Mittel, um Ziele zu erreichen.“67 „Die Voraussetzung der Überwindung des Kapitalismus ist die organisierte, politisierte Masse, die über die Konjunkturen spontaner Proteste hinweg einem Ziel entgegengeht. Die politische Aufgabe zur Förderung dieses Prozess ist die Herstellung und Verteidigung proletarischer Gegenmacht. In allen gesellschaftlichen Bereichen – Betriebe, Stadtteile, im kulturellen und Bildungsbereich – sind Institutionen und Netzwerke zu schaffen, in denen sich die Gesellschaft zusammenschließt und ihre Interessen durchsetzt. In der Arbeiterbewegung trugen diese Institutionen den Namen Räte/Sowjets oder Kommunen. Sie sind Kampforganisationen sowie Keimformen einer künftigen Demokratie.“68
Sieht man von der Begriffsverwendung von Gegenmacht – welche wie oben geschildert mit dutzenden völlig unterschiedlichen reformistischen, revisionistischen und anarchistischen Auffassungen verknüpft ist – einmal ab, kann man sich dem Kern dieser Ausführungen in Bezug auf die Frage der kommunistischen Massenarbeit nur anschließen. Kommunist:innen haben die Aufgabe, ihre eigene Klasse zu organisieren und diese Organisationsformen in der Praxis zu Stützpunkten im Kampf gegen das Kapital und zu Keimformen einer kommenden Rätemacht zu machen – auch wenn die Räte selbst erst im Prozess der Revolution entstehen werden, und nochmal ganz anders aussehen werden als heute zu schaffende Organisationsformen. Damit wird zudem das organisatorische Rückgrat dafür geschaffen, dass die Arbeiter:innenklasse im Sozialismus auch real die Macht ausüben kann. Besonders interessant ist darauf aufbauend aber die Frage, wie man diese Schritte gehen soll und welche Instrumente man dafür wann benötigt.
Der Rote Aufbau Hamburg beschreibt in einem aktuellen Artikel „in Anlehnung an den italienischen Marxisten und Politiker Antonio Gramsci Gegenmacht als den schrittweisen Griff nach der Hegemonie, welche damit im Widerspruch zur sozialen Macht und politischen Herrschaft des Kapitals steht“69. Dabei gehe es darum, „gesellschaftliche Mehrheiten“ zu erobern und zur „reellen Gefahr für ihr System“ zu werden. Ebenfalls erklären sie in dem Artikel, dass in der „Zivilgesellschaft“ der „Kampf um Hegemonie“ ausgefochten werden müsse.
Den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci (1891-1937) bei Fragen von Macht und Hegemonie heranzuziehen, ist berechtigt. Er hat sowohl den Ersten Weltkrieg, den Höhepunkt der weltweiten Arbeiter:innenbewegung 1917-1919 als auch den italienischen Faschismus als wichtiger Aktivist, Theoretiker und später Anführer der italienischen Kommunist:innen miterlebt und sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt.
Gramsci spricht jedoch an keiner einzigen Stelle in seinem Werk von Gegenmacht, Gegenhegemonie dem „schrittweisen Griff nach Hegemonie“ oder der Eroberung „gesellschaftlicher Mehrheiten“ und schlägt auch nirgends vor, mit der Bourgeoisie um die Hegemonie innerhalb der Zivilgesellschaft zu streiten – und das ist kein Zufall. In seinem nicht fertig gestellten letzten Werk vor der Gefangenschaft (als er noch unzensiert schreiben konnte) erklärte er zum Verdienst der Turiner Kommunist:innen in der italienischen Rätebewegung um 1920 – das heißt in einer akut revolutionären Situation: „Die Turiner Kommunisten hatten sich konkret die Frage der „Hegemonie des Proletariats“ gestellt, das heißt die Frage der sozialen Basis der proletarischen Diktatur und des Arbeiterstaats. Das Proletariat kann in dem Maße zur führenden und herrschenden Klasse70 werden, wie es ihm gelingt, ein System von Klassenbündnissen zu schaffen, das ihm gestattet, die Mehrheit der werktätigen Bevölkerung gegen den Kapitalismus und den bürgerlichen Staat zu mobilisieren“71
Die Frage der Hegemonie des Proletariats ist bei Gramsci also unmittelbar mit der sozialen Basis der proletarischen Diktatur, das heißt der in der revolutionären Situation geschaffenen Rätemacht und damit der Eroberung der Macht verbunden, sowie mit der Frage des Bündnisses mit der Bäuer:innenschaft, die sich 1920 eben „konkret“ stellte und zwar insofern, als dass große Teile der Turiner Arbeiter:innen gewonnen waren, die Bäuer:innenschaft aber noch nicht genügend.
Diese Gedanken formulierte er in abstrakter Form im faschistischen Gefängnis weiter aus, jedoch nicht für die Veröffentlichung bestimmt und unter den Bedingungen der Zensur, sodass seine Texte einiger „Übersetzungsarbeit“ bedürfen: „Das methodologische Kriterium (…) ist folgendes: dass sich die Suprematie [=Vorherrschaft] einer gesellschaftlichen Gruppe [=Klasse]auf zweierlei Weise äußert, als ‚Herrschaft‘ und als ‚intellektuelle und moralische Führung‘ [=Hegemonie]. Eine gesellschaftliche Gruppe ist herrschend gegenüber den gegnerischen Gruppen, die sie ‚auszuschalten‘ oder auch mit Waffengewalt zu unterwerfen trachtet, und sie ist führend gegenüber den verwandten und verbündeten Gruppen. Eine gesellschaftliche Gruppe kann und muss sogar bereits führend [=hegemonial] sein, bevor sie die Regierungsmacht erobert (das ist eine der Hauptbedingungen für die Eroberung der Macht); danach, wenn sie die Macht ausübt und auch fest in Händen hält, wird sie herrschend, muss aber weiterhin auch ‚führend‘ sein.“72
Auch wenn Gramsci keine konkreten Zeiträume nennt, analysiert er auch hier die Frage der Hegemonie des Proletariats als eine „Hauptbedingung“ für die Eroberung der Macht, welche zur proletarischen Diktatur führt, in welcher das Proletariat nicht nur führend gegenüber den verbündeten Klassen ist, sondern auch herrschend gegenüber der Bourgeoisie ist. Von einem schrittweisen Prozess, in dem eine „Gegenhegemonie“ geschaffen wird, ist aber auch hier keine Rede. Tatsächlich ist es im Gegenteil eher unrealistisch, davon auszugehen, die Kommunist:innen könnten in einem langsamen Prozess – quasi linear – „gesellschaftliche Mehrheiten“ erobern und lange vor einer revolutionären Situation wirklich die führende politische Kraft innerhalb der gesamten Arbeiter:innenklasse sein. Auch die Bolschewiki wurden erst in der Phase zwischen Februar- und Oktoberrevolution 1917 wirklich führend innerhalb der Arbeiter:innenklasse und gegenüber der Bäuer:innenschaft – als die Machteroberung unmittelbar bevorstand.
Das bedeutet nicht, dass es nicht notwendig ist, dauerhaft auf diesen Zustand hinzuarbeiten! Das bedeutet, eigene Kampforgane unserer Klasse zu schaffen und eine klassenkämpferische Arbeiter:innenbewegung aufzubauen. Hegemonial werden die Kommunist:innen innerhalb der Klasse und die Klasse gegenüber den verbündeten Klassen jedoch erst unmittelbar vor der Revolution werden. Diese Hegemonie gilt es dann während der Diktatur des Proletariats zu halten und weiter auszubauen.
Dazu schreibt Gramsci während der revolutionären Aufstände in Italien 1919: „Damit dieses Ziel [die proletarische Diktatur, Anm. d. Autoren] erreicht werden kann, erzieht die kommunistische Partei das Proletariat dazu, seine Klassenmacht zu organisieren und sich dieser wohl gerüsteten Macht zu bedienen, um die bürgerliche Klasse zu beherrschen und die Bedingungen festzulegen, durch die die ausbeutende Klasse unterdrückt wird und nicht wiedererstehen kann. Die Aufgabe der kommunistischen Partei in der proletarischen Diktatur ist deshalb: die Klasse der Arbeiter und Bauern endgültig in einer herrschenden Klasse zu organisieren; zu kontrollieren, dass alle Organe des neuen Staates wirklich revolutionär arbeiten und die Vorrechte und alten, durch das Prinzip des Privateigentums bedingten Verhältnisse zerstören.“73
Diese Notwendigkeit einer starken Kommunistischen Partei für die Frage der Klassenmacht wird von Gramsci in den revolutionären Aufständen, während der Phase der Bolschewisierung der italienischen Kommunistischen Partei als auch später in seinen Gefängnisheften74 immer wieder betont.
Genau deshalb ist es problematisch, wenn die Genoss:innen, die sich stark auf ihn beziehen, diese Frage in eine weit entfernte Zukunft verschieben: „Erst wenn unsere Gruppe eine relevante Arbeit in Hamburg entwickelt hat, kann man sich über eine bundesweite Vernetzung mit anderen revolutionären Gruppen zusammen setzen, welche zum Ziel hat, eine bundesweite Organisation zu gründen, die statt eines Papiertigers ein Totengräber dieser Gesellschaft sein kann“75, heißt es etwa beim Roten Aufbau.
Auch BdK verschiebt den Parteiaufbau in eine fernere Zukunft. Zwar sei „eine einheitliche bundesweite Organisation „neuen Typs“ auf Grundlage des Demokratischen Zentralismus und auf der Höhe unserer Zeit“ eine „notwendige Antwort auf die Krise der Linken in diesem Land“. Diese Organisation entstehe aber „nicht durch das bloße „Ausrufen“ dieser, sondern aus Strukturen, die sich durch tatsächliche, kleinteilige Arbeit in der Klasse verankert haben und nur in diesem Zusammenspiel entsteht erst das Potential für eine tatsächliche Gegenmacht unserer Klasse.“76
Roter Aufbau und BbK formulieren richtige Ansprüche in Bezug auf die kommunistische Massenarbeit in der Klasse und die Aufgaben, vor denen alle Kommunist:innen stehen. Ebenso nehmen sie eine richtige Einschätzung verschiedener Fallen vor, in die Kommunist:innen nicht tappen dürfen. Jedoch scheint ihre Vorstellung von Gegenmacht ebenso mit einer Theoretisierung des Zirkelwesens einherzugehen, wie es auch ausformuliert beim Revolutionären Aufbau Schweiz zu finden ist. Das heißt, sie lehnen eine kommunistische Partei (bzw. „bundesweite revolutionäre Organisation“ oder „bundesweite Organisation neuen Typs“) zwar nicht grundsätzlich ab, verschieben ihre Schaffung jedoch in eine unbestimmte Zukunft.
Aber ab wann ist es denn dann soweit, die Frage des einheitlichen bundesweiten Aufbaus einer Kommunistischen Partei anzugehen? Welche quantitativen und qualitativen Kriterien sind dafür anzulegen und wie sollen diese erreicht werden? Was muss geschehen, bevor man sich an die „notwendige Antwort auf die Krise der Linken in diesem Land“ heranwagt bzw. die objektive Möglichkeit (die ja aktuell verneint wird) dazu überhaupt sieht?
Strategische Schlussfolgerungen
Viele der in diesem Text aufgeworfenen brennenden strategischen Fragen bleiben in den Strukturen die sich auf Konzepte der Gegenmacht beziehen bewusst oder unbewusst über Jahre oder Jahrzehnte der politischen Arbeit sowohl theoretisch, als auch praktisch unbeantwortet. Damit beschränken sie objektiv die Möglichkeiten der organisatorischen Weiterentwicklung und eine Klärung über den Weg des Parteiaufbaus in der kommunistischen Bewegung und verfestigen das Zirkelwesen der revolutionären und kommunistischen Bewegung in Deutschland.
Dabei ist sind doch gerade die dialektisch verbundenen strategischen Fragen des Parteiaufbaus und des Wideraufbaus einer allseitigen klassenkämpferischen Arbeiter:innenbewegung Fragen, auf die wir im Angesicht der sich immer schneller zuspitzenden Widersprüche und Angriffe von oben dringende Antworten geben müssen.
Die schrittweise Überwindung des Zirkelwesens würde schon heute einen massiven Fortschritt für die kommunistische Bewegung bedeuten. Natürlich bringen mutige Schritte auf diesem Weg auch wieder neue Fragen und Probleme mit sich, die jedoch dazu da sind, von uns als kommunistischer Bewegung gelöst zu werden und nicht vor ihnen in Passivität zu verfallen.
Um es klar zu sagen: Die kommunistische Partei entsteht nicht spontan, nicht im richtigen Moment, sondern an ihrem Aufbau müssen wir dauerhaft und planvoll arbeiten. Die Frage des Parteiaufbaus stellt sich nicht in einer entfernten Zukunft, sie stellt sich jetzt. Ohne diese Aufgabe anzunehmen und an ihrer Lösung zu arbeiten bleiben auch die fortschittlichsten Genoss:innen und kämpferischsten Gruppen in einer Sackgasse, der Sackgasse des ewigen Zirkelwesens, stecken. Das Gegenmachtkonzept und seine Absage an einen klaren strategischen Weg zum Parteiaufbau konstruiert dieser politischen Sackgasse jedoch eine theoretische Grundlage.
Durch sein theoretisch begründetes Ziel, des Kampfes um die Hegemonie in der politischen Widerstandsbewegung, anstatt der Hegemonie der kommunistischen Bewegung und Partei in der Arbeiter:innenklasse, verewigt das Gegenmachtkonzept das Zirkelwesen in Theorie und Praxis. Es führt zur immer neuen Reproduktion von kleinen Zirkeln auf niedriger Organisationsstufe und einem starken Drang nach Abgrenzung gegen andere Aufbauprojekte, welche die eigene angestrebte oder propagierte Hegemonie durch die eigene politische Arbeit in Frage stellen könnte. Lokales bzw. regionales Königreichdenken, Selbstbezogenheit auf die eigene Gruppe und Identität, sowie ein Klammern an einzelne Arbeitsfelder und Zielgruppen anstatt einer allseitigen Entwicklung sind typische Ausprägungen die mit dem Zirkelwesen verbunden sind.
Wir haben gezeigt, dass der Begriff der Gegenmacht mit höchst unterschiedlichem Inhalt gefüllt ist. Vom reformistischen „Platz am Verhandlungstisch“ und autonom-utopischen Vorstellungen, welche der Machtfrage ausweichen, über militaristische Abweichungen bis zu Konzepten in der revolutionären Bewegung, welche eine revolutionäre Politik auf lange Sicht ohne Parteiaufbau anstreben. Da Gegenmacht mit so vielen unterschiedlichen, falschen und vagen Konzepten verbunden ist, ist sie nicht nur inhaltlich, sondern schon allein als Begriff für die wissenschaftliche Klärung der Strategiefrage ungeeignet.
Diese unterschiedlichen Konzepte von Gegenmacht entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern dahinter stehen materielle Gründe: Sie alle greifen bestimmte einzelne Entwicklungen auf, die in den Klassengesellschaften im Widerstand gegen die Ausbeutung spontan entstehen und bei denen einzelne Freiräume und Rechte erkämpft werden können, wie z. B. im Arbeitsprozess, in der politischen Widerstandsbewegung, und nicht zuletzt international in nationalen Befreiungsbewegungen etc. Die unterschiedlichen Theorien stellen dabei verschiedene Aspekte dieser spontanen Prozesse ins Zentrum. Damit wird sich begnügt, und dann theoretisiert, wieso es richtig ist, hierbei stehenzubleiben und die Machtfrage, die eng mit den Fragen der sozialistischen Revolution und des Parteiaufbaus zusammenhängt, letztlich zu umgehen.
Doch unser Ziel als Kommunist:innen ist nicht Gegenmacht, sondern die Eroberung der Macht. Wir können davon ausgehen, dass dies nicht mit den Kapitalist:innen am Verhandlungstisch oder durch das Parlament erreicht werden kann, sondern nur durch die revolutionäre Zerschlagung des Staatsapparats. Eine solche Revolution kann jedoch nicht einfach durch einen Willensakt hervorgerufen werden, sondern es benötigt objektive Bedingungen, damit dies möglich ist. Woran wir arbeiten können, sind die subjektiven Bedingungen, die organisatorischen, politischen und ideologischen Voraussetzungen, um im Falle einer revolutionären Situation die Verhältnisse umstürzen zu können.
Wir benötigen dafür eine organisierte klassenkämpferische Arbeiter:innenbewegung und eine in der Arbeiter:innenklasse verankerte Kommunistischen Partei. Diese muss im Zentrum eines Netzwerks aus Strukturen der Arbeiter:innenbewegung stehen, welche systematisch daran arbeiten, alle Kampfformen anzuwenden: Vom gewerkschaftlichen Streik bis zur wilden Betriebsbesetzung; von der offenen Massenpresse bis hin zu illegalen Zeitungen; von der Flugblattverteilung bis zur Miliz usw. Diese Strukturen müssen die gesamte Bandbreite an Organisationsformen abdecken: von offen bis konspirativ; in den Betrieben, Universitäten, Schulen, Stadtteilen; dort wo Menschen in Bewegung geraten sind und dort wo es erst untergründig gärt.
Politisch muss es uns dabei gelingen, die Tagesnöte unserer Klasse ebenso wie die großen politischen Forderungen aufzugreifen und in den Kampf um die Revolution einzubetten. Dafür muss der gezielte Eingriff in die aktuellen politischen Ereignisse und Bewegungen mit einer dauerhaften Verankerungsarbeit in allen Teilen unserer Klasse verbunden werden.
Ideologisch gilt es, die kommunistische Theorie durch Auswertung der vergangenen und heutigen Erfahrungen auf die Höhe der Zeit zu heben und innerhalb der kommunistischen Bewegung eine Vereinheitlichung im Kampf um eine solche revolutionäre Linie herzustellen. Mit diesem Text haben wir versucht, einen Beitrag zu diesem Klärungsprozess zu leisten.
1„Marxistische Arbeiterschulung (MASCH), Kursus: Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung, Die deutsche Sozialdemokratie in der Periode des Ausnahmegesetzes (1878 bis 1890), Ein Jahr der Verwirrung“, Verlag für Literatur und Politik, Wien/Berlin 1930, Reprint 1970, S. 175
2Stützle, Ingo (2020): Staatstheorien. In: associazione delle talpe: Staatsfragen – Einführungen in die materialistische Staatskritik. https://talpe.org/files/staatsfragen_neuauflage.pdf
3Vgl. dazu Naphali, Fritz (1928): Wirtschaftsdemokratie, https://archive.org/details/WirtschaftsdemokratieIhrWesenWegUndZiel
4In: Galbraith, J. Kenneth (1956): American Capitalism: The Concept of Countervailing Power.
5Vgl. Seibring SPD Gewerkschaften 1998-2005. https://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/bestand/7862435/spd_gewerkschaften_1998_2005_magisterarbeit_seibring.pdf, S. 27
6Bei Gewerkschaften ist der Gegenmachtsbegriff schon länger in Diskussion: „Teils in Konkurrenz, teils als Ergänzung zur Sozialpartnerschaft standen und stehen innerhalb der DGB-Gewerkschaften Konzepte der »Gewerkschaft als Gegenmacht«.“ Dribbusch, Birke 2012: Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland.
7Vgl. Becker, Jens (2022): Otto Brenner: Der kämpferische Gewerkschaftsführer. In: https://jacobin.de/artikel/otto-brenner-der-kampferische-gewerkschaftsfuhrer-igmetall-dgb-wirtschaftsdemokratie-demokratischer-sozialismus
8Nach der Konstituierung der DKP gehörte Abendroth zusammen mit anderen Vertreter:innen der sogenannten Marburger Schule und DKP-nahen Wissenschaftler:innen aus anderen Städten der Bundesrepublik dem Wissenschaftlichen Beirat des in Frankfurt am Main ansässigen DKP-eigenen Instituts für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF) an.
9Vgl. dazu bspw.: Kommunistischer Aufbau (2024): Marxismus und Revisionismus. https://komaufbau.org/marxismus-und-revisionismus/
10Vgl. Peters, Jürgen (2006): Rede zur Eröffnung der Konferenz „Arbeiterbewegung – Wissenschaft – Demokratie. Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Abendroth“. https://www.igmetall.de/download/0017198_peters_eroeffnung_abendroth_060506_d88c2d2d0953d79e40194735354a155c7ad89f96.pdf
11Baumann, Kurt (2022): Integration oder Gegenmacht?. https://www.unsere-zeit.de/integration-oder-gegenmacht-170044/
12Deutsche Kommunistische Partei (2006): Programm der Deutschen Kommunistischen Partei, https://dkp.de/wp-content/uploads/programmatik/DKP-Programm.pdf, S. 29
13Diese Position fand sich in den 70er Jahren auch in den Reihen der Jusos wieder. Ziel ihrer damaligen „Doppelstrategie“ sei die „Demokratisierung aller Lebensbereiche“, welche durch „systemüberwindende Reformen“ erreicht werden sollten. Sie beinhaltet, durch sogenannte „Basisarbeit“ „Gegenmachtpositionen der Lohnabhängigen aufzubauen und von dort ausgehend auf die staatliche Wirtschaftspolitik einzuwirken“ und so auch die Politik der SPD zu verändern. Sie zielt auf die „Verbindung von außerparlamentarischer Mobilisierung und institutioneller Reform“ (Karsten D. Voigt). Dabei näherte man sich auch der DKP an, mit der man ein antimonopolistisches Bündnis gegen die Monopole organisieren könne (jedoch nicht mit den K-Gruppen).Vgl. Willi Dickhut, RW 18/19, S. 374
14https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Bundesparteitag/2009_bpt_dresden_protokoll_.pdf
15Redaktion Vorwärts (2010): Die Mitte ist links. https://vorwaerts.de/parteileben/die-mitte-ist-links
16IG Metall (2016): 125 Jahre selbstbewusste Gegenmacht. https://www.igmetall-wob.de/meldung/ig-metall-125-jahre-selbstbewusste-gegenmacht
17Isaf Gün/Benedikt Hopmann/Reinhold Niemerg (Hrsg.) (2019): Gegenmacht statt Ohnmacht – 100 Jahre Betriebsverfassungsgesetz: Der Kampf um Mitbestimmung, Gemeineigentum und Demokratisierung. https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/gegenmacht-statt-ohnmacht/
18Holz, Stefanie / Wilde, Florian (2020): Macht gemeinsame Sache, S.11. In: Jane Mc Alevey: Macht. gemeinsame Sache – Gewerkschaften, Organizing und der Kampf um die Demokratie. S. 11. https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/sonstige_texte/VSA_McAlevey_Macht_Gemeinsame_Sache.pdf
19Van der Walt, Lucien / Schmidt, Michael (2013): Schwarze Flamme – Revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus und Syndikalismus Schwarze Flamme, S. 36
20Kropotkin, Pjotr Alexejewitsch (1903): Moderne Wissenschaft, S. 114., Zitiert nach: Lucien/Schmidt (2013): 96
21Lucien/Schmidt (2013): 221
22Lucien/Schmidt (2013): 238
23IWW (1909): One Big Union. S.30. https://www.wobblies.org/wp-content/uploads/2017/09/OBU-A5-2014.pdf
24Vgl. Persmateriaal van de groepen van internationale Communisten (1931): Der Unterschied in den Auffassungen der I.W.W. und der Rätebewegung in Deutschland. http://aaap.be/Pdf/Pressedienst-GIK/PIK-1931-April.pdf
25Zuvor hatte die Komintern bereits intensiv um die IWW geworben. Vgl. Zinoviev, G. (1920): To the I.W.W. A Special Message from the Communist International. https://www.marxists.org/history/international/comintern/sections/australia/iww/open-letter.htm.
26Vgl. dazu „Plädoyer gegen den »Spanischen Exzeptionalismus«“ in Lucien/Schmidt (2013): 339 ff.
27Auch die Politik der Kommunist:innen in Spanien sowie der Komintern hierzu sollte allseitig und kritisch ausgewertet werden. Dies muss jedoch an anderer Stelle geschehen.
28Der Operaismus ist eine Strömung in der Arbeiter:innenbewegung, welche in Italien in den 70er und 80er Jahren stark war. Diese sahen sich selber als Marxisten, lehnten jedoch leninistische Gedanken wie das Parteikonzept ab. Das revolutionäre Subjekt sahen sie im ungelernten Fabrikarbeiter.; Der Postoperaismus löste sich dann später noch weiter von Marxismus und der Arbeiter:innenklasse als revolutionärem Subjekt und der Fabrik als zentralem Kampffeld.
29Negri, Antonio (2018): French Insurrection, https://www.versobooks.com/blogs/news/4158-french-insurrection
30Interventionistische Linke (2024): Zwischenstandspapier #2: Gegenmacht aufbauen, Gelegenheiten ergreifen. https://interventionistische-linke.org/sites/default/files/il_zwischenstand_2024_text.pdf, S.1
34Holloway, John (2004): Zwölf Thesen über Anti-Macht. https://www.rosalux.de/publikation/id/1921/zwoelf-thesen-ueber-anti-macht/
35Holloway, John (2005): Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, In: Kurswechsel 1/2005, S. 36
36Ebd.
37Holloway, John (2004): Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, Vortrag 2004 in Berlin
38https://www.wsws.org/en/articles/2024/01/07/rwdm-j07.html
39Bookchin entwickelte die Theorie eines „libertären Munizipalismus“. Öcalan studierte sein Werk „die Ökologie der Freiheit“ im Gefängnis und hielt sogar eine Briefkorrespondenz mit Bookchin.
40Vgl. Öcalan, Abdullah (2004): Jenseits von Staat, Macht und Gewalt.
41Ausgeco2hlt (2017): Wurzeln Im Treibsand – Reflexionen und Werkzeuge von und für die Klimagerechtigkeitsbewegung, S. 13
42Das „Historisch-Kritische Wörterbuch des Marxismus“ versucht dennoch „Gegenmacht“ als „marxistischen Begriff“ zu Framen, was an keiner Stelle belegt wird: „Der Aufbau von G ist ein Projekt; sie wird durch die Organisation des Proletariats erreicht, und man kann erst dann von einer G sprechen, wenn sie die bürgerliche Macht ernsthaft bedrohen und eine Alternative zu ihr bieten kann“, heißt es dort.
43Rote Armee Fraktion (1976): Erklärung zur Sache: Geschichte der BRD. In: Ausgewählte Dokumente der Zeitgeschichte: Bundesrepublik Deutschland (BRD) – Rote Armee Fraktion (RAF), GNN Verlagsgesellschaft Politische Berichte, 1. Auflage Köln Oktober 1987
44 „Spiegel-Interview“. In: Ausgewählte Dokumente der Zeitgeschichte: Bundesrepublik Deutschland (BRD) – Rote Armee Fraktion (RAF), GNN Verlagsgesellschaft Politische Berichte, 1. Auflage Köln Oktober 1987
45Marighella veröffentlichte 1970 das Minihandbuch des Stadtguerillero welches eine kondensierte Zusammenfassung des Konzept Stadtguerilla umfasst.
46Rote Armee Fraktion (1976): Erklärung zur Sache: Geschichte der BRD. In: Ausgewählte Dokumente der Zeitgeschichte: Bundesrepublik Deutschland (BRD) – Rote Armee Fraktion (RAF), GNN Verlagsgesellschaft Politische Berichte, 1. Auflage Köln Oktober 1987
47Vgl. dazu Marx, Karl (1852): Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte.: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“
48Camus, Albert (1951): Der Mensch in der Revolte.
49Revolutionaerer Zorn (1975): Revolutionärer Zorn Ausgabe 1 (Mai 75)
50In: Kommunistische Revolutionäre (2012): Ansätze des revolutionären Aufbruchs in Italien. https://www.gefangenen.info/3607/die-fruehlingskampagne-die-operation-moro/
51„Durch den Zusammenschluss dreier vorbestehender Gruppierungen (KGI, MarLen und RGA) sowie der Sammlung von im Migrationsbereich aktiven GenossInnen zum neu gegründeten Migrationskomitee war der Revolutionäre Aufbau gegründet, auch wenn es keinen formellen Gründungsakt mit genauem Datum gab.“
52Revolutionärer Aufbau Schweiz (2012): 20 Jahre revolutionärer Aufbau, S.9-11
53Revolutionärer Aufbau Schweiz (2011): Zur Kritik der RSO am revolutionären Aufbau. https://www.aufbau.org/2011/01/25/zur-kritik-der-rso-am-revolutionn-aufbau-2/
54Dieses „Primat der Praxis“ bildet auch den Kern der eigenen Schulungsarbeit und entspringt den Mao’schen Einflüssen der Organisation. Vgl. „Schulung und politische Formierung“ (2012) in: Revolutionärer Aufbau Schweiz (2012): 20 Jahre revolutionärer Aufbau, S. 72
55Revolutionärer Aufbau Schweiz (2011): Zur Kritik der RSO am revolutionären Aufbau. https://www.aufbau.org/2011/01/25/zur-kritik-der-rso-am-revolutionn-aufbau-2/
56Revolutionärer Aufbau Schweiz (2011): Zur Kritik der RSO am revolutionären Aufbau. https://www.aufbau.org/2011/01/25/zur-kritik-der-rso-am-revolutionn-aufbau-2/
57Revolutionärer Aufbau Schweiz (2011): Zur Kritik der RSO am revolutionären Aufbau. https://www.aufbau.org/2011/01/25/zur-kritik-der-rso-am-revolutionn-aufbau-2/
58Revolutionärer Aufbau Schweiz (2007): Politische Plattform, S. 8
59ebd.
60Revolutionärer Aufbau Schweiz (2010): Warum hat der Kampf um und auf der Strasse strategische Bedeutung?
61ebd.
62Revolutionärer Aufbau Schweiz (2007): Politische Plattform, S.10
63ebd.
64„Die Politisierung von derjenigen, die sich revolutionär organisieren, geschieht heute selten über den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es sind Themen wie Rassismus oder Sexismus, die globalen Ungerechtigkeiten des Kapitalismus oder die Fragen der staatlichen Repression, welche bewegen.“ In: „Gemeinsam sind wir stärker – revolutionäre Praxis heute“, Aufbau 89. https://www.aufbau.org/2017/04/30/gemeinsam-sind-wir-staerker-revolutionaere-praxis-heute/
65Revolutionärer Aufbau Schweiz (2007): Politische Plattform, S. 9
66Im Gegensatz zum RAS aus der Schweiz bezieht sich PK nicht offen in ihren Grundlagen darauf, dass es eine Kommunistische Partei braucht
67Bund der Kommunist:innen (2024): „Gegenmacht aufbauen“ – aber wie?. https://kommunist-innen.org/wp-content/uploads/2024/07/BDK_Gegenmacht-aufbauen-aber-wie-Antwort-auf-Zwischenstandspapier-der-IL.pdf
68Bund der Kommunist:innen (2024): Programm. https://kommunist-innen.org/programm;
69 Roter Aufbau (2024): Unsere Seite aufbauen – Revolutionäre Gegenmacht im Aufbauprozess: Wie kann dies konkret aussehen? In: LuttjeLüd (2024), Nr. 1
70Bemerkenswert ist das Gramscis spätere Unterscheidung in „Führung“ (Hegemonie) und „Herrschaft“ schon 1926 auftaucht und später in den Gefängnisheften vertieft wird.
71Gramsci (1926): Einige Gesichtspunkte der Frage des Südens.
72Alle Anmerkungen in Eckigen Klammern sind eigene Intepretationen der Autoren. Gramsci 2019: Bd 8, H 19, § 24, S. 1947
73Gramsci, Antonio (1919): Die Gewerkschaften und die Diktatur. https://www.marxists.org/deutsch/archiv/gramsci/1919/10/gewerk.html
74Dort schreibt Gramsci unter anderem, „das wichtigste Ziel“ des Proletariats sei es „seine eigene Gruppe unabhängiger Intellektueller zu konstitutieren“. „Unabhängige“ oder auch „organische Intellektuelle“ nutzt Gramsci um über die Kader:innen der Arbeiter:innenklasse zu sprechen. Vgl. Gramsci 2019: H8, S. 1810
75Roter Aufbau (2015): Selbstverständnis, http://roter-aufbau.de/?page_id=45
76Bund der Kommunist:innen (2024): „Gegenmacht aufbauen“ – aber wie?. https://kommunist-innen.org/wp-content/uploads/2024/07/BDK_Gegenmacht-aufbauen-aber-wie-Antwort-auf-Zwischenstandspapier-der-IL.pdf