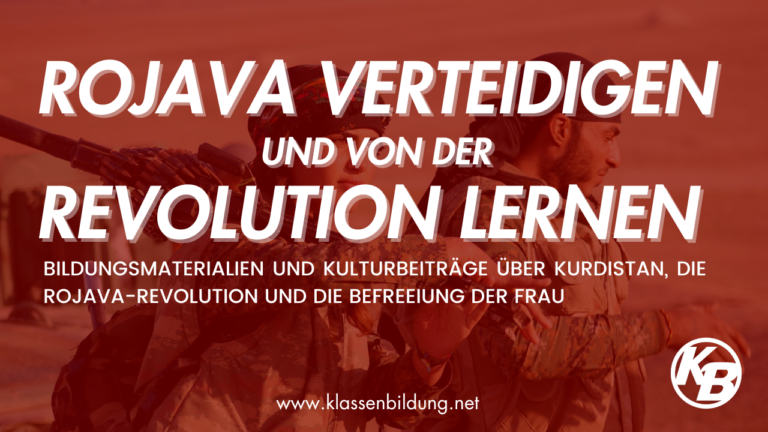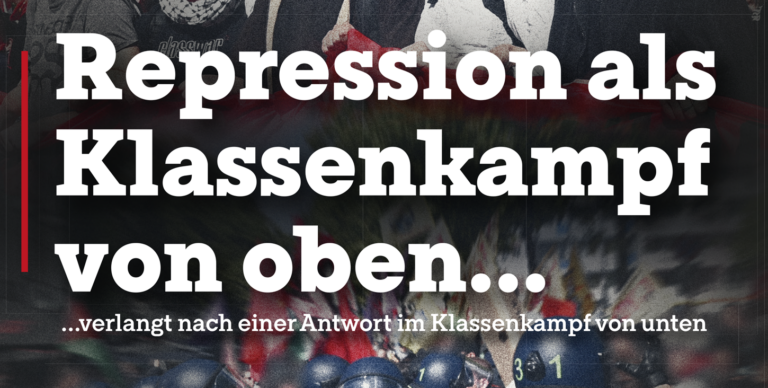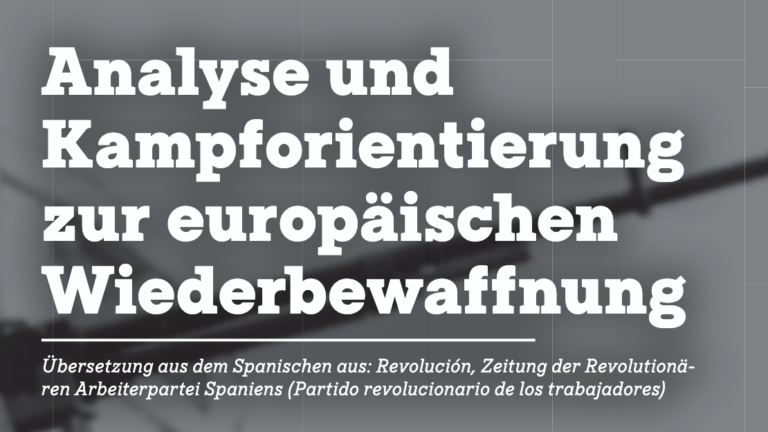Die Gewerkschaftsfrageist so alt wie die Arbeiter:innenbewegung selbst. Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle Gewerkschaften im Kampf um die Befreiung der Arbeiter:innenklasse einnehmen, und wie die Kommunist:innen mit diesem Instrument arbeiten sollten.
Wichtige Grundlagen, um hier zu Antworten zu kommen, hat bereits Karl Marx (1818-1883) in seinem klassischen Werk „Lohn, Preis, Profit“ klar dargelegt: „Gewerkschaften tun gute Dienste als „Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals“. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d. h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems.“1
Diese grundlegende Ausrichtung ist nach wie vor gültig. Auch heute benötigen wir Arbeiter:innen Gewerkschaften als „Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals“ die aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus wiederkehrend auf uns einprasseln und im alltäglichen Kampf abgewehrt werden müssen. Sie müssen jedoch auch „als ein Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d. h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems“ dienen, da die Angriffe durch das Kapital so lange andauern werden, wie der Kapitalismus existiert. Wollen wir also aus dem Hamsterrad unserer Ausbeutung ausbrechen, benötigt es nämlich die Überwindung der Lohnarbeit als Ganzes.
Solche Organisationen haben wir als Arbeiter:innenklasse in Deutschland heute dringend nötig. In den letzten Jahren stehen wir besonders unter Beschuss: Die Teuerungen haben zu massiven Reallohnverlusten geführt. Zudem gibt es in nahezu allen Bereichen der Industrie seit 2024 einen massiven Stellenabbau oder die Ankündigung dessen – allen voran in der Autoindustrie, die mit ihren großen Monopolen und den Zulieferunternehmen eine zentrale Rolle in der deutschen Wirtschaft spielt. Auch die Insolvenzen stiegen Anfang 2025 auf Rekordniveau.
Die Folgen davon müssen wir Arbeiter:innen ausbaden. Die Kapitalist:innen drohen uns nicht nur mit Entlassungen, sondern greifen darüber hinaus unsere Rechte an. Sie fordern eine höhere Wochenarbeitszeit oder ein späteres Renteneintrittsalter, verlangen von uns mehr Überstunden zu machen und wollen Krankheitstage nicht mehr bezahlen.2 Ideologisch werden diese Debatten mit Begriffen wie fehlender „Arbeitsmoral“ und „Arbeitseffizienz“ aufgeladen um Teile der Klasse selbst hinter diesen Forderungen zu versammeln und diese Angriffe zu rechtfertigen.
Bürgerliche Ökonom:innen liefern uns derweil immer wieder neue „Antworten“, mit denen konkrete Teilereignisse als Gesamtursache für die aktuelle Krise herhalten sollen. So war es zunächst alleine die Corona-Pandemie, die für den wirtschaftlichen Einbruch verantwortlich gemacht wurde, später der Ukraine-Krieg und aktuell wird in der Autoindustrie der verpasste Umstieg auf die Elektromobilität als Hauptursache auserkoren. Sicherlich hatten diese Ereignisse starken Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Allerdings ist ein zentrales Element von wirtschaftlichen Krisen, dass sie innerhalb des Kapitalismus zyklisch wiederkehren. Nach der letzten großen Krise 2008/2009 gab es eine längere Phase des Aufschwungs, die zwangsläufig in eine weitere Überproduktionskrise münden musste. Diese zeigte ihre Auswirkungen 2018/2019. Was wir heute spüren, sind einerseits noch die Nachwirkungen dieser Krise selbst, andererseits aber auch die Folgen eines durch Pandemie und Krieg krass verzerrten Krisenzyklus. Zugleich zeigen sich strukturelle Probleme des deutschen Imperialismus, dessen exportorientiertes Erfolgsmodell immer stärker unter Druck gerät.3
Wie steht es in dieser Situation nun um die Gewerkschaften in Deutschland? Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) als größter gewerkschaftlicher Dachverband in Deutschland, in dem mehrere Millionen Arbeiter:innen organisiert sind, steht bei dieser Frage in den meisten Diskussionen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Schauen wir uns also exemplarisch an, welche Rolle er in einigen Auseinandersetzungen der letzten Jahre eingenommen hat:
- Während der Corona-Pandemie sagte der DGB die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ab. Zum einen sorgte er damit für eine Nullrunde in einer der bedeutendsten Branchen in Deutschland. Zum anderen gab er in einer Situation, in der so viele Menschen in Kurzarbeit waren wie noch nie zuvor in der Geschichte der BRD, in der ein Kampf (unter Einbeziehung des Gesundheitsschutzes) so notwendig für unsere Klasse gewesen wäre, das zentrale Kampfmittel des Streiks in der Branche mit dem höchsten „Organisierungsgrad“ bewusst aus der Hand.
- Nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges im Jahr 2022 gab es vom DGB keinen Widerstand gegen das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr, sondern eine ideologische Unterstützung der Kriegsinteressen des deutschen Imperialismus. Von der grundlegenden Idee der Arbeiter:innenbewegung, dass „Arbeiter:innen nicht auf Arbeiter:innen schießen“ war hier nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die IG Metall rief zusammen mit SPD und dem zentralen Lobbyverband der Rüstungsindustrie zur weiteren Aufrüstung auf.4
- Im Zuge der darauffolgenden Energiekrise erlebte die Arbeiter:innenklasse so hohe Inflationszahlen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch der DGB begab sich 2022 zum zweiten Mal nach 1967 in die „Konzertierte Aktion“, wo er mit Kapital und Politik einen Pakt schloss, die Reallöhne langfristig zu senken und mit Einmalzahlungen abzufedern. In der Folge haben wir gesehen, wie in einer Tarifrunde nach der anderen Reallohnverluste abgeschlossen wurden.
- Bei dem seit über einem Jahr vor den Augen der Welt stattfindenden Völkermord an den Palästinenser:innen in Gaza machte sich der DGB an der Seite der israelischen Gewerkschaft Histadrut zum Komplizen. Gegen Gewerkschafter:innen, die dagegen protestierten, ging er aktiv vor.5
- Auch zu den angekündigten Massenentlassungen und Werksschließungen bei VW Ende letzten Jahres führte der DGB lediglich Aktionen zum Dampf ablassen durch und organisierte trotz laufender Tarifrunde keinen ernsthaften Widerstand gegen diese Angriffe. Dass es innerhalb des DGB auch fortschrittliche Postionen und kämpferische Mitglieder gibt, die immer wieder konsequente Arbeitskämpfe anzetteln, verändert an den grundlegenden Problemen wenig. Zum einen bewegen sich diese trotzdem meistens im Rahmen des „Kleinkriegs gegen die Wirkungen des bestehenden Systems“. Zum anderen ist die DGB-Führung und der hauptamtliche Apparat der Einzelgewerkschaften sehr gut geübt darin, selbst diese spontane Widerständigkeit in geordnete Bahnen zu lenken und damit zu sabotieren.
Um zu verstehen, warum der DGB heute so handelt, welche Interessen dem zugrunde liegen und was unsere Haltung dazu als Kommunist:innen sein sollte, möchten wir uns in diesem Text mit folgenden Fragen beschäftigen:
- Warum sind die DGB-Gewerkschaften heute nicht die notwendigen Strukturen wie von Marx gefordert? Was hat ihre Entstehungsgeschichte damit zu tun und wie haben sie sich bis heute entwickelt?
- Wie können wir die klassischen Ausführungen von Lenin zur notwendigen „Arbeit in den reaktionären Gewerkschaften“ auf heute anwenden?
- Wie kann eine konsequent klassenkämpferische Politik in der Gewerkschaftsfrage und Schritte in die Richtung notwendiger revolutionärer Gewerkschaftsorganisationen für unsere Klasse aussehen?
Wie ist der DGB einzuschätzen?
Die Vorläufer des DGB
Mit der Herausbildung der deutschen Arbeiter:innenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich auch ihre Organisationsformen. Nach ersten regional und beruflich beschränkten kleinen Gewerkschaften und ihrem Verbot zur Zeit der Sozialistengesetze (1878-1890) gründete sich 1890 die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands(GK) als erster gewerkschaftlicher Dachverband im Deutschen Reich. Die GK stand klar unter der Kontrolle der damals noch revolutionären SPD. Doch bereits im Jahr 1905 hatten sich die reformistischen Kräfte klar durchgesetzt, gegen die Marx und Engels jahrzehntelange ideologische Kämpfe geführt hatten. In diesem Jahr beschloss der Reichskongress der GK eine klare Trennung der politischen und ökonomischen Kämpfe, was von der SPD ein Jahr später wiederum bestätigt wurde. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs beging die GK dann zusammen mit der SPD den Verrat an der Arbeiter:innenklasse durch die Unterstützung der Kriegskredite, welche Kaiser Wilhelm II. zur Kriegsführung benötigte. Während des Ersten Weltkriegs waren es dann revolutionäre Kräfte in und außerhalb des ADGB, welche die großen Arbeiter:innenstreiks anführten.
Mit der Novemberrevolution1918/1919 erkämpfte die revolutionäre deutsche Arbeiter:innenbewegung die demokratische Republik, wurde jedoch durch den erneuten Verrat der SPD und den Einsatz des Militärs am Voranschreiten zur sozialistischen Revolution gehindert. Nach der Niederschlagung der Novemberrevolution wurde dann im Juli 1919 der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) gegründet. Dieser stand von Beginn an unter führendem Einfluss der SPD. Die Kommunistische Partei Deutschlands(KPD) hatte sich gerade erst mit ihrer Gründung Ende 1918 von der SPD organisatorisch losgelöst und unterstützte noch längerer Zeit den Zusammenschluss aller Arbeiter:innen im ADGB. Hintergrund dessen war auch, dass der ADGB im Kampf zur Verteidigung der demokratischen Republik und gegen den aufkommenden Faschismus zu Beginn eine relevante Rolle einnahm. 1920 konnte noch mit dem größten Generalstreik der deutschen Geschichte der Kapp-Putsch verhindert werden.
Zugleich verschmolz der ADGB immer stärker mit dem Staatsapparat der Weimarer Republik: Unter Friedrich Ebert und Hermann Müller war er durch die SPD direkt an der Regierungspolitik beteiligt und wurde darüber hinaus in das Reichsarbeitsministerium durch aktive Mitarbeit an Gesetzen sowie in verschiedenen ministeriellen Beiräten und Kommissionen eingebunden. Hinzu kam der Aufbau einer institutionalisierten Form der Tarifverhandlungen, bei denen Kapital und ADGB-Gewerkschaften im Sinne der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung des deutschen Imperialismus Arbeits- und Lohnbedingungen aushandelten. Im „Schlichtungsfall“ kam das Reichsarbeitsministerium ins Spiel. Auch wenn der ADGB nicht ursprünglich von der Kapital-Seite gegründet worden war, entwickelte er sich immer mehr zum integralen Teil des deutschen Kapitalismus und Co-Manager für das Kapital und wurde somit zu einer gelben Gewerkschaft. Besonders augenfällig wurde diese Zusammenarbeit während der ersten großen Weltwirtschaftskrise 1928, als der ADGB eine aktive Streikpolitik verhinderte und Sozialabbaumaßnahmen unterstützte, obwohl die Krise massives Elend für die Arbeiter:innenklasse brachte. Gegen rebellierende Arbeiter:innen in den eigenen Reihen begann die ADGB-Führung eine rigorose Ausschlusspolitik
[Kasten „Gelbe Gewerkschaften“:
Der Begriff der „gelben Gewerkschaft“ kommt aus der frühen französischen Arbeiter:innenbewegung. Damals wurden von dem französischen Syndikalisten Pierre Biétry (1872-1918) die Gewerkschaft Fédération nationale des Jaunes de France in Abgrenzung zur Confédération générale du travail (CGT) gegründet, die von Anarchist:innen und Kommunist:innen dominiert war. Anstatt auf Klassenkampf sollte die neue „Gewerkschaft“ auf friedliche Verhandlungen mit dem Unternehmen setzen, über welche ein starker Staat wachen sollte. In Abgrenzung zum „roten“ Sozialismus bezeichnete sich seine Bewegung selbst als „gelber Sozialismus“. Später schwor die Bewegung jeglicher sozialistischer Elemente ab. Auch in anderen Ländern entstanden in diesem Sinne gelbe Gewerkschaften, die sich in erster Linie durch ihre Feindschaft zum Marxismus und ihren korporatistischen Ansatz gegenüber Unternehmen auszeichneten. Der Begriff der gelben Gewerkschaft wurde in dessen Folge umgekehrt auch von sozialistischen Gewerkschafter:innen genutzt, um sich gegenüber ebensolchen gelben Gewerkschaften abzugrenzen, die im Interesse von Kapital und Staat agierten.]
Als Antwort darauf entwickelte die KPD nach mehreren parteiinternen Auseinandersetzung bis 1929 dann in der Gewerkschaftsfrage die Politik der Revolutionären Gewerkschaftsopposition (RGO). Dem vorausgegangen war eine organisatorische und politische Festigung der Partei ab Mitte der 20er Jahre. Hier hatten die Betriebe im Organisationsaufbau eine immer größere Rolle eingenommen. Dies hing mit der „Bolschewisierung“ ab 1925 zusammen, in deren Zusammenhang sich die KPD mehr an dem Aufbaukonzept der Bolschewiki orientierte, welche ihren Einfluss maßgeblich auf kommunistische Zellen in den Betrieben gestützt hatten. Damit sah sich die KPD nun gefestigt genug – und zugleich durch die äußeren Umstände dazu gedrängt – ihre Gewerkschaftslinie anzupassen.
Ursprünglich waren die Ziele der RGO:
- eine oppositionelle Arbeit innerhalb des ADGB gegen die sozialdemokratische und reformistische Politik zu entfalten,
- Arbeiter:innen innerhalb und außerhalb des ADGB gemeinsam zu organisieren, nachdem vor allem Kommunist:innen bereits ausgeschlossen wurden,
- eine Verbindung zwischen Arbeiter:innen, Arbeitslosen und Mitgliedern der freien, außerhalb des ADGB stehenden Gewerkschaften herzustellen.
Zu Beginn der RGO-Politik konnten „Rote Listen“ als Konkurrenz zu den ADGB-Listen in einigen Betrieben bei den Betriebsratswahlen starke Erfolge erzielen. Der ADGB reagierte mit scharfer Repression gegen die Mitglieder der RGO, indem er sie nicht nur aus den ADGB-Gewerkschaften ausschloss, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Kapitalist:innen ihre Entlassungen aus den Betrieben durchsetzte. So sank die Zahl der KPD-Mitglieder in den Industriebetrieben zwischen 1928 und 1931 von 63% auf knapp 20%. Die RGO und damit auch die KPD verlor trotz einiger Erfolge in einzelnen Betrieben unter anderem dadurch sehr schnell an Masseneinfluss und war nach wenigen Jahren deutlich isolierter von den restlichen Teilen der Klasse. Nachdem das Hauptziel der Schaffung einer Opposition innerhalb des ADGB nicht mehr umgesetzt werden konnte – auch weil die Kommunist:innen aufgrund der Massenausschlüsse schlichtweg nicht mehr Mitglieder im ADGB waren – orientierte die RGO zunehmend auf den Aufbau einer eigenen roten gewerkschaftlichen Organisation. Dabei konnte sie jedoch aufgrund der fehlenden Massenbasis keine großen Erfolge mehr vor der Machtübertragung an die Faschisten im Jahr 1933 erzielen.
Der deutsche Faschismus stellte ohne Zweifel das dunkelste Kapitel für die Gewerkschaftsbewegung in diesem Land dar. Die ADGB-Führer versuchten sich zu Beginn mit den Hitlerfaschist:innen zu arrangieren und so beging man am 1. Mai 1933 gemeinsam den „Tag der nationalen Arbeit“. Einen Tag später wurden die Gewerkschaftshäuser von den Nazis besetzt und sämtliche Strukturen des ADGB gliederten sich in die am 10. Mai 1933 gegründete Deutsche Arbeitsfront (DAF) ein. Ab dann kam es zur Abschaffung der meisten Rechte der Arbeiter:innen, Verfolgung, Inhaftierung und Ermordung von gewerkschaftlich aktiven Menschen.Während sich Teile der gewerkschaftlichen Basis an das neue System anpassten, flüchteten andere ins Exil. Eine Reihe von Gewerkschafter:innen begaben sich auch in den antifaschistischen Widerstand, der jedoch nicht so stark wurde, dass er das System von innen entscheidend in Gefahr brachte. Deutschland wurde im Mai 1945 von außen, unter wesentlichem Anteil der Roten Armee, befreit.
Die Gründung des DGB als fest integrierte gelbe Gewerkschaft
Schon als sich das Ende des Nazi-Regimes abzeichnete, begannen im Exil die Vorbereitungen für den Wiederaufbau gelber Gewerkschaften. Deutlich wird das an einem Zitat des ehemaligen ADGB-Funktionärs Fritz Tarnow (1880-1951), der bereits 1944 deutlich machte: „Beim Wiederaufbau deutscher Gewerkschaften stehen wir vor dringenden Aufgaben. Es ist gewiss, dass eine der Hauptaufgaben der deutschen Arbeiter die Forderung nach Einheit sein wird und sie werden versuchen, starke nichtpolitische Verbände von Industriegewerkschaften zu schaffen, oder vielleicht sogar Gewerkschaften verlangen, die alle Arbeiter umschließen (Einheitsgewerkschaften). Wir müssen dies um jeden Preis verhindern trachten, da es den Kommunisten die Möglichkeit geben würde, die Gewerkschaften zu beherrschen. Daher müssen wir jetzt mit den britischen und den amerikanischen Stellen die geeigneten Vorkehrungen treffen, damit wir so schnell wie möglich (nach Deutschland, d.V.) zurückkehren können, um die Entwicklung antikommunistischer Gewerkschaften zu leiten. Wir dürften auf die Mitarbeit der (westlichen, d.V.) Militärbehörden rechnen (…), da es ebenso in ihrem wie in unserem Interesse liegt.“6
Tatsächlich fand nach dem Zweiten Weltkrieg die Bildung neuer Gewerkschaften in Westdeutschland unter strenger Aufsicht der USA, Großbritanniens und Frankreichs statt. Zentralen Einfluss hatten die US-amerikanischen Besatzungsbehörden. Sie wollten eine Gewerkschaft nach dem Vorbild der American Federation of Labor (AFL) aufbauen, die auf Basis der Ideologie des „free trade unionism“ ihre Kämpfe rein auf ökonomische Anliegen beschränkte und antikommunistisch ausgerichtet war.
Mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund(DGB), der ab 1949 geschaffen wurde, gelang dann das Kunststück, sowohl dem Ruf nach „Einheitsgewerkschaften“ Rechnung zu tragen und zugleich die Kommunist:innen Stück für Stück heraus zu drängen. Dafür wurde ein Dachverband aufgebaut, der offiziell alle politischen Strömungen und Berufsgruppen eingliedern sollte. Er umfasst bei seiner Gründung 16 verschiedene Einzelgewerkschaften. Sowohl der DGB als auch die jeweiligen Einzelgewerkschaften wurden in eine bundesweite Ebene, eine Länderebene und eine lokale Ebene unterteilt. Auf den lokalen Ebenen gab es dann noch verschiedene Formen von AGs und Ausschüssen. Was auf den ersten Blick also nach einer demokratischen, unabhängigen Gewerkschaft aussah, war faktisch eine noch stärker in das System des deutschen Kapitalismus integrierte gelbe Gewerkschaft.
So trat der DGB im Bezug auf die Verschmelzung mit Staat und Kapital in die Fußstapfen des ADGB. Die Führungsposten der Gewerkschaft wurden mit SPD-Politikern wie Hans Böckler (1875-1951) besetzt, die sich bereits in der Weimarer Republik durch eine besonders antikommunistische Politik hervorgetan hatten. Die SPD war weiterhin entscheidendes Bindeglied zwischen Staat und DGB. Zugleich ordnete sich der DGB noch „offizieller“ in das bundesdeutsche Wirtschaftssystem ein. Hatte der ADGB noch die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien gefordert, bekräftigte der DGB nun ganz offen den als „soziale Marktwirtschaft“ bezeichneten deutschen Kapitalismus. Mit dem vom DGB mit vorangetriebenen Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 wurde die paritätische Besetzung von Aufsichtsräten7 in Deutschlands wichtigsten Monopolen festgelegt und damit das spezifisch deutsche System der „Sozialpartnerschaft“ geschaffen, welches die Gewerkschaftsspitzen zu Co-Manager:innen macht.
Der DGB und sein Kampf gegen links
So wie alle gelbe Gewerkschaften zeichnete sich auch der DGB durch seinen aktiven Kampf gegen Kommunist:innen in seinen Reihen aus. Schon kurz nach seiner Gründung wurden die Kommunist:innen an den Rand des DGB gedrängt. Dabei musste man rabiat vorgehen, denn die KPD hatte beispielsweise bei den Betriebsratswahlen im Jahr 1946 in der Kohleindustrie in NRW – und damit dem Kern des deutschen Monopolkapitalismus – 38,8 Prozent der Stimmen erhalten. Das waren gut zwei Prozent mehr als die SPD. Dieser Einfluss wurde nicht akzeptiert, was sich an insgesamt 650 Ausschlüssen von KPD-Mitgliedern in den 1950er Jahren aufgrund von „gewerkschaftsfeindlichem Verhalten“ zeigte, da diese sich weigerten, sich schriftlich vom Parteiprogramm der Partei zu distanzierten. Dabei half es auch nicht, dass sich die KPD selber in dieser Zeit mehr und mehr nach rechts entwickelte und sich der Sozialdemokratie anbiederte. Der DGB folgte damit der Linie der Bundesregierung, die bereits 1951 Berufsverbote gegen KPD-Mitglieder im öffentlichen Dienst erließ und im selben Jahr das Verbotsverfahren gegen die Partei einleitete.8
Da wo einzelne Ausschlüsse nicht ausreichten, schreckte der DGB auch nicht davor zurück, ganze Landesverbände aufzulösen, in denen die Kommunist:innen zu stark waren. Dazu gehörte etwa der Bezirk Nordrhein der IG Bau mit 49.000 Mitgliedern, der im Jahr 1956 vollständig aufgelöst und neu gegründet wurde. Betriebliche und staatliche Repression ergänzten sich: Mit dem KPD-Verbot im selben Jahr war die kommunistische Bewegung zu diesem Zeitpunkt deutlich geschwächt.
Erst mit der 68er Bewegung gab es wieder einen Aufschwung der kommunistischen Bewegung, der jedoch in den Strukturen des DGB sogleich mit weiteren Ausschluss- und Auflösungswellen einherging. So wurde nach langen internen Auseinandersetzungen der gesamte Landesverband der GEW in Westberlin ausgeschlossen. Noch heute spricht die GEW in einem Geschichtsrückblick offen über die reaktionären Gründe: „Die ,linken’ Tendenzen der jungen Mitglieder wurden auch in Berlin heftig bekämpft. Als links galt jede*r, die die etablierten Machtstrukturen in Frage stellte und Partizipation verlangte. So erklärte der damalige Vorsitzende der GEW BERLIN, Dietrich Schaeffer, kurzerhand eine Forderung nach Senkung der Teilungsfrequenz für alle Grundschulklassen von 35 auf 30 als umstürzlerisch.“9
1972 erließen Bund und Länder zusammen den „Radikalenbeschluss“, um kritische Kräfte aus dem öffentlichen Dienst auszuschließen. Es kam zu einer immer stärker werdenden Repression gegen die 1968 neu gegründete DKP sowie verschiedene „K-Gruppen“, die sich am Marxismus-Leninismus orientierten. Der DGB schloss sich dieser Entwicklung an: Im Jahr 1973 wurde ein „Unvereinbarkeitsbeschluss“ getroffen, wonach Mitglieder von K-Gruppen kein Mitglied in DGB-Gewerkschaften sein dürfen. Er differenzierte hier jedoch und ließ die Mitglieder der DKP weitestgehend unbehelligt, da diese sich in ihrer Gewerkschaftspolitik vollkommen dem DGB unterordneten.10 Es folgten an die 1000 weitere Ausschlüsse, sowie verweigerte Neuaufnahmen von Mitgliedern, welche in den K-Gruppen aktiv waren. Auch der Rechtsschutz wurde Gewerkschafter:innen verweigert, welche unter dem Verdacht standen, K-Gruppen-Mitglieder zu sein. Das führte dann z. B. dazu, dass Lehrer:innen, die ein Berufsverbot erhielten, von den DGB-Gewerkschaften aufgrund ihrer politischen Gesinnung keinen Rechtsschutz mehr erhielten, um gegen das Berufsverbot vorgehen zu können.
In dieser Situation gingen einige K-Gruppen dazu über, das Konzept der RGO wiederzubeleben. Dabei blieben die Konzepte sehr nah an denen der Parteien angelehnt, welche diese historisch initiiert hatten, 11. Zugleich traten sie in der Praxis durchaus immer wieder gemäßigter auf. So erklärte Peter Vollmer (geb. 1940): „Die von mir initiierte Kandidatenliste zur Betriebsratswahl 1978 im Kabelwerk Winkler mit dem Namen ‚Frischer Wind‘ war damals schon eine RGO-Liste, in deren Programm ‚Revolution‘ nicht vorkam. Streng genommen stellte sie nach der damaligen Begrifflichkeit eine ‚rechtsopportunistische Abweichung‘ von der RGO-Politik dar. Das wurde jedoch vermutlich wegen des guten Wahlergebnisses nie offen kritisiert.“12 Diese RGO konnte also sehr wohl Arbeiter:innen organisieren und sich in der Klasse verankern. Wenn es hart auf hart kam und ökonomische Forderungen durchgesetzt werden sollten, hatten die Arbeiter:innen keine Probleme, Kommunist:innen zu folgen. Aber das hieß noch lange nicht, dass sie für den Kommunismus gewonnen waren oder bereit gewesen wären, im Klassenkampf für den Sozialismus aktiv zu werden. Die schwierige Aufgabe, den ökonomischen Tageskampf in den Kampf um den Sozialismus einzubetten und Arbeiter:innen zu politisieren, gelang auch ihnen nicht in ausreichendem Umfang. Die allermeisten Betriebsaktivist:innen, die in den 80er Jahren nicht direkt die Seiten gewechselt haben, endeten als kämpferische Gewerkschafter:innen im Reformismus. Statt Kommunist:innen aus der Arbeiter:innenklasse durch die Betriebsarbeit zu gewinnen, haben die K-Gruppen also reihenweise Kader:innen an die Sozialdemokratie verloren. Das dahinter stehende Problem, eine revolutionäre Politik mit der Eroberung der Mehrheit der Arbeiter:innen unter imperialistischen Bedingungen richtig zu verbinden, blieb eine nach wie vor ungelöste Aufgabe.
Nach der erfolgreichen Integration und Repression gegenüber der revolutionären Bewegung in Politik und Gewerkschaft in den 70er Jahren folgte nach der Annexion der DDR 1989/1990 der nächste Tiefpunkt für die kommunistische Bewegung in Deutschland. Die meisten K-Gruppen verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Eine Ausnahme stellt dabei die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands(MLPD) dar, deren organisatorische Kontinuität bis in die Zeit der K-Gruppen zurück reicht und die auch in den 90ern noch eine Arbeit in den DGB-Gewerkschaften aufrecht erhalten konnte. Nachdem man ihr kein „gewerkschaftsfeindliches Verhalten“ vorwerfen konnte, ging der DGB dazu über, die Ausschlüsse gegenüber MLPD-Mitgliedern nicht aufgrund von konkretem Fehlverhalten, sondern lediglich aufgrund der sozialistischen Gesinnung und dem Ziel einer revolutionären Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft zu begründen.
Ein bedeutendes Beispiel, wie auf der anderen Seite eine erfolgreiche Integration von Kommunist:innen verlaufen kann, ist die Karriere von Bertold Huber (geb. 1950). Dieser startete seine Arbeit im DGB als Teil des Kommunistischen Arbeiterbund Deutschlands – dem Vorläufer der MLPD – und arbeitete sich dann bis zum Betriebsratsvorsitzenden bei VW hoch. Der VW-Konzern vertraute Huber so sehr, dass er im Jahr 2015 sogar Aufsichtsratsvorsitzender des größten deutschen Monopols wurde.
Auch wenn es heute vereinzelt noch Ausschlüsse gibt, die jedoch häufig auch stark auf persönlichen Konflikten oder Machtkämpfen beruhen, kann man sagen, dass der DGB es inzwischen weitestgehend geschafft hat, den Einfluss der Kommunist:innen gering zu halten oder sie so zu integrieren, dass das Ausnutzen ihrer politischen Erfahrung und Arbeitsdisziplin den gewerkschaftlichen Apparat stärkt, anstatt die kommunistische Bewegung oder die Entwicklung des Klassenkampfes. Wenn es doch mal rebellischer wird, dann greifen bereits früh subtile Formen des gleichen Systems. So werden z. B. Ortsverbände mit widerständigen Kolleg:innen mit anderen Ortsverbänden zusammengelegt oder Kolleg:innen in andere Ämter versetzt. Auch das Locken mit den bestens bezahlten hauptamtlichen Funktionärsposten ist ein beliebtes Mittel, um oppositionelle Tendenzen im Zaum zu halten.
Der DGB heute
Zwischen 1991 und 2024 halbierte sich die Mitgliederzahl des DGB von 11,8 Millionen auf 5,58 Millionen.13 Auch durch die in den vergangenen Jahren vermehrt eingesetzten „Organizing“-Strategien und die bezahlte externe Mitgliederanwerbung konnte dieser Prozess nur abgebremst, aber nicht umgekehrt werden. So verlor allein die Gewerkschaft Verdi 2024 innerhalb eines Jahres 1,73 Prozent ihrer Mitglieder, der DGB insgesamt 1,53 Prozent. Mit 34 Prozent sind Frauen zudem stark unterrepräsentiert in den Reihen des DGB. Allein bei Verdi machte darüber hinaus im Jahr 2024 der Anteil der Rentner:innen 17,6 Prozent der Mitglieder aus.14 2012 gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung an, dass insgesamt 27 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos oder in Rente sind.15 Somit organisiert der DGB derzeit weniger als 10 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland.
Der Umstand, dass der DGB die größten Angriffe auf die Arbeiter:innenklasse der letzten beiden Jahrzehnte mitgetragen hat, hat die Situation sicherlich nicht besser gemacht. Sowohl an der Planung und Umsetzung der Agenda 2010 als auch an der gesetzlichen Verankerung der Leiharbeit war der DGB maßgeblich beteiligt. Durch das 2015 beschlossene Tarifeinheitsgesetz versuchte der DGB, konkurrierende Gewerkschaften, die erfolgreiche Arbeitskämpfe durchführen wie z. B. die GDL, zu schwächen.
Dass der DGB so offensichtlich arbeiter:innenfeindlich agiert, hängt zum einen damit zusammen, dass er systematisch mit staatlichen Institutionen verschmolzen ist. Es gibt dafür nicht nur offensichtliche Beispiele wie die „Konzertierte Aktion“, oder dass fast alle Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften Mitglieder der Monopolpartei SPD sind. Sondern der DGB-Apparat ist auch organisch an mehreren Stellen direkt in den Staatsapparat des deutschen Imperialismus integriert: Er ist in verschiedenen Gremien der Regierung und Verwaltung wie Bundestagsausschüssen und der Mindestlohnkommission vertreten. Als Teil des Sozialversicherungssystems macht der DGB ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit aus. Auch in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung und der Rentenversicherung ist der DGB in den Verwaltungsorganen vertreten. Hierüber sind bereits verschiedene Klassenkämpfe von oben geführt worden, wie etwa die Einführung von Zusatzbeiträgen oder ein voranschreitender Leistungsabbau.
Hinzu kommt, dass er selbst zahlreiche kapitalistische Unternehmen führt. Bereits früh entwickelte der DGB eigene unternehmerische Tätigkeiten, welche offiziell mit dem Füllen der Streikkassen begründet wurden, in der Realität jedoch zur Profitmacherei führten. Ein prominentes Beispiel ist die „Neue-Heimat-Affäre“ aus dem Jahr 1982. Seit 1952 hatte der DGB mit der „Neuen Heimat“Europas größten Wohnungsbaukonzern aufgebaut. Statt umfangreichen sozialen Wohnungsbau zu organisieren, steckten sich die Vorstände jedoch Millionen in die eigenen Taschen. Auch heute verwaltet der DGB weiterhin unzählige Immobilien im ganzen Land und hat sich mit der Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften GmbH(früher BGAG) sein eigenes Kapitalverwaltungsunternehmen geschaffen. „Die BGAG spielt eine bedeutende Rolle in der deutschen Wirtschaft und ist ein wichtiger Akteur auf dem Kapitalmarkt. Ihre Beteiligungen unterstützen nicht nur die Gewerkschaften, sondern tragen auch zur Stärkung der deutschen Unternehmenslandschaft bei“16, frohlockt dazu ein Aktienratgeber.
Dass all diese Strukturen nicht dem Arbeitskampf zugute kommen, zeigt ein Blick auf die Finanzen der IG Metall. Ihr Gesamtvermögen wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt – davon seien laut einem Bericht der Tagesschau17 aus dem Jahre 2022 rund 1,1 Milliarden Euro in der Streikkasse. Demgegenüber steht, dass der kostenintensivste Streik der IG Metall innerhalb der letzten 25 Jahre gerade einmal 27 Millionen Euro gekostet hat (2018).
Der Unternehmenscharakter schlägt sich auch auf die personelle Zusammensetzung des Gewerkschaftsapparats nieder. Auf dem Papier gibt es zwar die Möglichkeit, die lokalen, regionalen und bundesweiten Vorstände demokratisch zu wählen und über Beschlüsse auf den Gewerkschaftskongressen abzustimmen. Die innergewerkschaftliche Demokratie zeigt jedoch ähnliche Begrenzungen auf wie der Parlamentarismus der bürgerlichen Demokratie. Natürlich ist es abstrakt-theoretisch möglich, sich in einem demokratischen Wahlverfahren mit klassenkämpferischen Positionen beispielsweise für einen Vorstand aufstellen zu lassen. Genau wie im Parlamentarismus ist der Erfolg einer solchen Kandidatur jedoch davon abhängig, inwieweit man sich an das System und seine Machtstrukturen anpasst. Hinzu kommt, dass im DGB ein bedeutender Teil der Hauptamtlichen wie z. B. die Gewerkschaftssekretär:innen nicht in einem demokratischen Prozess gewählt werden können, sondern diese Stellen durch ein klassisches Ausschreibungsverfahren besetzt werden, das sich nicht von einem kapitalistischen Betrieb unterscheidet. Im Alltag kommen dann noch die üblichen Machtspielchen und Konkurrenzkämpfe um die besten Posten dazu, die wir auch aus allen anderen Bereichen der bürgerlichen Gesellschaft kennen.
Während es durch etliche ehrenamtliche Arbeitskreise zu den unterschiedlichsten Themenfeldern eine Integration kämpferischer Kräfte in den demokratischen Apparat gibt, so zeigen sich die Begrenzungen dieser Demokratie auch ganz deutlich beim Herzstück der gewerkschaftlichen Aktivitäten, den betrieblichen Kämpfen:
Die Tarifrunden laufen inzwischen so ab, dass in einer kurzen Periode zu Beginn der Tarifrunde groß Stimmung gemacht wird und einige wenige Warnstreikaktionen organisiert werden, auf denen dann versucht wird, fleißig Mitglieder zu werben. Gegen Ende der angesetzten Verhandlungen kommt es dann doch wieder zu einer Einigung, die in jedem Fall als größtmöglicher Erfolg verkauft wird, egal ob sie einen Reallohnverlust bedeutet oder nicht. Dabei übergehen Tarifkommissionen auch gerne Mal die demokratischen Abstimmungen für Streiks, wie zuletzt im Poststreik 2023.18
Hinzu kommt: In den kurzen Phasen der (Streik-)Aktivität setzt der DGB inzwischen vermehrt auf „Organizer:innen“, die von eigens dafür aufgebauten Firmen für den Zeitraum der Tarifrunde angeheuert werden und möglichst viele organisatorische Aufgaben übernehmen. Das führt letztendlich dazu, dass die Kampferfahrungen nach Beschäftigungsende verloren gehen und von der Belegschaft an die „Organizer:innen“ abgegeben werden. Das Stellvertretertum der DGB-Funktionär:innen wird dadurch nochmals verstärkt und die Rolle der Millionen Mitglieder immer weiter reduziert.
Wie wenig der DGB mit einer Kampforganisation für die Interessen der Arbeiter:innenklasse zu tun hat, wurde zuletzt bei seiner Reaktion auf die angekündigten Entlassungswellen in der deutschen Industrie deutlich – das eigentliche „Kerngeschäft“ der IG Metall als stärkster DGB-Gewerkschaft. Insbesondere bei VW, dem Vorzeigebetrieb der deutschen Sozialpartnerschaft, half die Gewerkschaft sogar bei der Abwicklung, als die Konzernführung Pläne zum Stellenabbau und zu Werksschließungen vorlegte. Die berechtigte Wut der Belegschaft konnte die IG Metall zunächst nicht abwimmeln und so kam es immer wieder zu spontanen Versammlungen und wilden Arbeitsniederlegungen der Arbeiter:innen. Nachdem es der IG Metall dann doch gelang, den Aufruhr in geordnete Bahnen zu lenken, stimmten sie am Verhandlungstisch einem massiven Stellenabbauprogramm zu und gaben alle Kampfmittel aus der Hand. Ähnliches Verhalten der DGB-Gewerkschaften können wir aktuell und historisch an unzähligen Beispielen feststellen. Es geht hier also nicht um einzelne Abweichungen oder Ausnahmen, sondern um die dauerhafte und systematische Abwiegelung und Befriedung von Arbeits- und Tarifkämpfen im Interesse des Kapitals.
Insgesamt befindet sich der DGB heute in einer strukturellen Krise. Millionen Arbeiter:innen haben das Vertrauen in den DGB verloren und fühlen sich nicht mehr von ihm vertreten. Seine Rolle als Vermittler der Positionen von Regierung und Kapital ist offensichtlich und er verliert auch real immer mehr an Einfluss und Durchsetzungskraft. Hinzu kommt, dass sich für viele Arbeiter:innen die Mitgliedschaft nicht lohnt, weil die eigene Branche ein blinder Fleck beim DGB ist, der sich mehr und mehr alleine auf Großbetriebe beschränkt (wo der DGB nach wie vor eine relevantere Kraft ist). Oder aber die Arbeiter:innen sind keine Mitglieder, weil sie keinen Sinn in dem immer gleichen Spektakel der Tarifrunden sehen, bei denen es eben nicht um einen organisierten Kampf gegen die Interessen des Kapitals geht, sondern vielmehr um einen faulen Kompromiss, bei dem die Gewerkschaftsvertreter:innen einen „Interessenausgleich“ im Rahmen der gesetzten klassenversöhnlerischen Sozialpartnerschaft verhandeln.
***
Abschließend können wir also feststellen, dass die Vorläuferorganisationen des DGB historisch bereits auf einem ökonomistischen Irrweg starteten und dann gemeinsam mit der Sozialdemokratie immer weiter nach rechts rückten. Schon in der Weimarer Republik begann der 1919 gegründete ADGB dann immer mehr mit dem Staatsapparat zu verschmelzen und zu einer Institution der Integration statt des Kampfes zu werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der DGB in seiner heutigen Form auf dem Papier als „unabhängige“ Einheitsgewerkschaft aufgebaut. Wir müssen ihn jedoch ganz klar als eine mit Staat und Kapital verwachsene gelbe Gewerkschaft bezeichnen. Kommunist:innen werden nur toleriert, solange diese sich anpassen und in der bedeutungslosen Minderheit bleiben, ansonsten werden sie mit allen Mitteln bekämpft und mit Repressionen überzogen. Die Funktion des DGB ist also die Absicherung des kapitalistischen Systems durch die Sozialpartnerschaft mit den Kapitalist:innen.
Mit Lenin für den DGB?
Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich: Die DGB-Gewerkschaften verfehlen die marxistische Ausrichtung für die notwendige Funktion von Gewerkschaften im Klassenkampf nicht nur teilweise, sondern gänzlich. Wir müssen sogar darüber hinaus gehen: Sie sind nicht nur eine „reformistische“ Gewerkschaft, sondern eine Organisation, welche die systematische Befriedung der Arbeiter:innenklasse und Integration von ihren Anführer:innen in das System des deutschen Imperialismus institutionalisiert hat. Ebenso wie beispielsweise eine Eroberung des bürgerlichen Staatsapparats unmöglich und deren Versuch politisch fatal ist, ist auch der Versuch, eine so in den Staatsapparat und das bürgerliche System integrierte Gewerkschaft zu erobern unmöglich und politisch fatal. Ebenso wie etwa der Versuch, das bürgerliche Parlament zu erobern historisch immer in einer Integration in dessen Apparat geendet hat, so muss auch der Versuch, eine gelbe Gewerkschaft wie den DGB zu erobern, in der Integration derer, die dieses versuchen, in das bürgerliche System enden.
Dies muss erst einmal Ausgangspunkt für jeglichestrategische Herangehensweise in dieser Frage sein. Diese Herangehensweise bedeutet in der umgekehrten Schlussfolgerung, dass wir auf dem Weg von jetzt zur sozialistischen Revolution Gewerkschaften als Arbeiter:innenbewegung schaffen müssen, die nicht nur Sammelpunkte gegen die Angriffe des Kapitals sind, sondern auch als ein Hebel zur Abschaffung des Lohnsystems, als Teil einer revolutionären Gesamtbewegung dienen.
Innerhalb der klassenkämpferischen und kommunistischen Bewegung ist diese Haltung jedoch wenig verbreitet. Viele Organisationen orientieren einen gewichtigen Teil ihrer Kräfte darauf, vor allem innerhalb der DGB-Strukturen zu arbeiten und damit zu versuchen, ihn langfristig zu beeinflussen oder zu erobern. Dafür, in Diskussionen darüber hinaus zu denken, setzen sie sich enge Grenzen, die sie durchaus leidenschaftlich verteidigen.
Bei der Verteidigung dieser scheinbaren Alternativlosigkeit beziehen sich viele am Marxismus orientierte Genoss:innen in ihrer Argumentation auf den russischen Revolutionär Wladimir I. Lenin und seine Schrift „Der linke Radikalismus – die Kinderkrankheit im Kommunismus“ (1920). Im Kapitel „Sollen Revolutionäre in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten?“19 setzte sich Lenin das Ziel, die Erfahrungen der Bolschewiki zu verallgemeinern, um sie für Westeuropa anwendbar zu machen und eine linksradikale Abweichung deutscher Kommunist:innen zu kritisieren. Auch wenn dieser Text über 100 Jahre alt ist, prägt eine schematische Übertragung seiner Zeilen bis heute die Debatte unter kommunistischen Gewerkschafter:innen, weshalb sich eine genauere Analyse aus heutiger Sicht lohnt. Lenin entwickelte in diesem Text nämlich eine Reihe an politisch-ideologischen Punkten in der Gewerkschaftsfrage, auf die wir im folgenden eingehen wollen, um dies zur Klärung einiger grundlegender Fragen für die kommunistische Strategiedebatte zu nutzen.
Gewerkschaften als Massenorganisationen für Revolution und sozialistischen Aufbau
Zu Beginn des Kapitels beschreibt Lenin, welche Rolle die Gewerkschaften in Russland nach der sozialistischen Revolution 1917 gespielt haben. Es handelte sich um einen „der Form nach nicht kommunistischen, elastischen und verhältnismäßig umfassenden, überaus mächtigen proletarischen Apparat, durch den die Partei mit der Klasse und der Masse eng verbunden ist und durch den, unter Führung der Partei, die Diktatur der Klasse verwirklicht wird.“ Daneben nennt er noch als wichtige Instrumente der Verbindung von Partei und Klasse die Sowjets sowie Versammlungen parteiloser Arbeiter:innen und Bäuer:innen. Er berichtet zudem darüber, wie sich dieser „Mechanismus im Laufe von 25 Jahren aus kleinen, illegalen, unterirdischen Zirkeln entwickelt“ habe. So haben sich in Russland die Gewerkschaften unter Führung der sozialdemokratischen Partei in der Illegalität aufgebaut und wurden immer wieder durch den Zarismus massiv unterdrückt.
Damit die Gewerkschaften diese Rolle im Sozialismus auch einnehmen können, müssten sie laut Lenin eine „Schule des Kommunismus“ sein, „eine Vorbereitungsschule für die Proletarier zur Verwirklichung ihrer Diktatur, eine unentbehrliche Vereinigung der Arbeiter für den allmählichen Übergang der Verwaltung der gesamten Wirtschaft des Landes in die Hände der Arbeiterklasse (aber nicht einzelner Berufszweige) und sodann aller Werktätigen.“
Wenden wir diese Positionen auf heute an, so können wir festhalten, dass auch in einer sozialistischen Revolution in Deutschland Instrumente der Massenorganisierung notwendig sind, die über eine verdeckt aufgebaute und aus Kader:innen bestehende Kommunistische Partei hinaus gehen. Dazu gehören vor allem Rätestrukturen in allen gesellschaftlichen Bereichen – Stadtteilen, Schulen usw. und insbesondere in den Betrieben. Letztere sind revolutionsstrategisch von besonderer Relevanz, da die Ökonomie die Basis der Gesellschaft bildet und deren Kontrolle zum sozialistischen Aufbau unerlässlich ist. Hier werden klassenkämpferische gewerkschaftliche Strukturen, in welcher hunderttausende bereits vor der Revolution organisiert sein müssen und im entscheidenden Moment für den Kampf um die Revolution unter Führung der Kommunistischen Partei mobilisiert werden können, eine zentrale Rolle spielen.
Solche Gewerkschaften können wir ebenso wie die Räte selbstredend heute noch nicht schaffen, sondern sie werden erst in der revolutionären Situation selbst Massencharakter annehmen. Und doch müssen wir – ebenso wie es die russischen Bolschewiki 25 Jahre vor der Revolution taten – schon heute die Keime für solche gewerkschaftlichen Strukturen legen, und dies in den Kern unserer betrieblichen Strategie aufnehmen.
Leider ist dieser Gedanke in der Debatte unter Kommunist:innen oftmals unterrepräsentiert. Viel zu oft wird in nicht von unserem strategischen Ziel – einer sozialistischen Revolution – ausgegangen, sondern sich am Status Quo abgearbeitet. Dementsprechend wird dann die Arbeit innerhalb des DGB in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.
Fordern Lenins Ideen uns auf, den DGB zu erobern?
Wie notwendig es ist, sich die konkrete Gewerkschaftsorganisation, über die wir sprechen, anzusehen, zeigt auch die Auseinandersetzung mit weiteren Aussagen Lenins. Er spricht 1920 bezüglich der westlichen Gewerkschaften von der „Tatsache, daß die Spitzen der Gewerkschaften reaktionär und konterrevolutionär sind“ und lehnt es zugleich ab, aus diesem Grund den Schluss zu ziehen „daß man … aus den Gewerkschaften austreten!!, die Arbeit in den Gewerkschaften ablehnen!! und neue, ausgeklügelte Formen von Arbeiterorganisationen schaffen müsse!!“.
Es wird hier deutlich, dass Lenin zum damaligen Zeitpunkt das Hauptproblem vor allem in einer Schicht an Bürokraten, vor allem in den Gewerkschafts-„Spitzen“, sieht. Daraus zieht er den Schluss, dass die Kommunist:innen die Arbeit in den Gewerkschaften nicht aufgeben dürfen. Und tatsächlich handelte es sich z. B. beim ADGB von 1920 um einen Apparat, der erst 1919 als Gewerkschaftsdachverband neu gegründet worden war, und dessen Vorläufer bis 1906 noch auf revolutionärer Grundlage standen. Im Ersten Weltkrieg war dieser dann, wie oben erwähnt, offen auf die Burgfriedenspolitik eingeschwenkt und von der SPD in der Führung dominiert worden, war jedoch auch in den Jahren zuvor und danach ein heiß umkämpftes Feld geblieben. Es war eine Phase, in welcher der ADGB ein relevanter Akteur im Generalstreik zur Niederschlagung des Kapp-Putsch war oder dazu aufrief, die Lieferung von Kriegsmaterial an Polen zu verhindern, welches von den Weißgardisten gegen die Rote Armee eingesetzt werden sollte.20 Große Teile seiner Basis hatten sogar an der Novemberrevolution teilgenommen und hunderttausende ADGB-Mitglieder waren aktiv in revolutionären Parteien wie der KPD und USPD.
Der DGB im Jahr 2025 ist jedoch nicht der ADGB von 1920! Schon 1920 spricht Lenin davon, dass sich im Westen bereits ein reaktionärer Geist „viel stärker geltend gemacht“ habe als in Russland. Er analysiert eine im Vergleich zu Russland „viel stärkere Schicht“ der „imperialistisch gesinnten und vom Imperialismus bestochenen, vom Imperialismus demoralisierten Arbeiteraristokratie“ die sich in den Gewerkschaften „festgesetzt“ habe. Bestimmte Kampfmethoden seien hier „schwerer durchzuführen“. Dennoch sieht er zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, den Kampf „bis zur völligen Diskreditierung aller unverbesserlichen Führer des Opportunismus und Sozialchauvinismus und ihrer Vertreibung aus den Gewerkschaften“ zu führen.
Heute existiert im DGB nicht nur diese „viel stärkere Schicht“ der Arbeiteraristorkatie, welche als Träger der Reaktion aus einer umkämpften Institutionen der Arbeiter:innenbewegung verdrängt werden könnte. Innerhalb der letzten 100 Jahre hat sich durch die Entwicklung des Imperialismus hier einiges verändert. Die Rolle, welche die Arbeiter:innenaristokratie insbesondere als Gruppe an Menschen eingenommen hat, wird heute auch von ganzen Institutionen der systematischen Integration eingenommen. Mit den DGB-Gewerkschaften ist die Funktion dieser Schicht praktisch institutionalisiert wordenund es wurde eine Organisation geschaffen, welche von ihrem gesamten Aufbau her systematisch Individuen in das System des deutschen Kapitalismus integriert. Mit welchen Mechanismen dies beim DGB von Kopf bis Fuß stattfindet und dieser dadurch mit dem deutschen Staatswesen ideologisch-politisch im weitesten Sinne verschmilzt, wurde weiter oben dargestellt. Heute davon auszugehen, man müsse nur die DGB-Spitzen absägen und man habe dann ein quasi leeres Gerüst, was man mit neuem Inhalt füllen könne, verschließt die Augen vor genau dieser historisch stattgefundenen Entwicklung. Jegliche Forderung nach „Eroberung“ der DGB-Gewerkschaften ist damit heute als realitätsferne Illusion abzulehnen.
In den reaktionären Gewerkschaften arbeiten?
Bleibt noch die Frage danach, ob man – auch wenn man sie nicht erobern kann – in den „reaktionären Gewerkschaften“ arbeiten muss? Hier hat Engels bereits klarstellt: „Nicht in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten heißt die ungenügend entwickelten oder rückständigen Arbeitermassen dem Einfluß der reaktionären Führer, der Agenten der Bourgeoisie, der Arbeiteraristokraten oder der verbürgerten Arbeiter überlassen“21. Dem ist auch heute noch zuzustimmen. Denn auch wenn die gelben Gewerkschaften heute anders als die Gewerkschaften von vor 100 Jahren funktionieren, ist nicht jede:r dort organisierte Arbeiter:in für die Revolution verloren. Ganz im Gegenteil bleibt es weiterhin dabei, dass sich dort noch über lange Zeit Arbeiter:innen sammeln werden, die spontan in den ökonomischen Kampf gegen das Kapital hineingezogen werden. Das ist auch der richtige Kern an einer oft vorgebrachten Argumentation, bei dem DGB handele es sich um die „größte Massenorganisationen der Arbeiter:innenklasse“. Tatsächlich sind dort quantitativ noch immer viele Arbeiter:innen versammelt und Lenin hat recht, dass wir die Aufgabe haben, „systematisch, hartnäckig, beharrlich, geduldig gerade in allen denjenigen – und seien es auch die reaktionärsten Einrichtungen, Vereinen und Verbänden Propaganda und Agitation zu treiben, in denen es proletarische oder halbproletarische Massen gibt“. Aber zugleich hat der DGB in den letzten Jahrzehnten massiv an Mitgliedern verloren und es ist heute mit ca. 10 Prozent (nach konservativer Schätzung der Anzahl an Rentner:innen, Studierenden und Arbeitslosen) nur noch ein kleiner Teil der Erwerbstätigen dort organisiert. Zum Vergleich: Im Jahr 1920 waren im ADGB noch rund 27 Prozent aller Erwerbstätigen und vermutlich ein noch größerer Anteil der Industriearbeiter:innen organisiert. Ein Großteil der Gewerkschaftsmitglieder ist heute nach wie vor in den großen Industriebetrieben und im öffentlichen Dienst konzentriert, wodurch die DGB-Gewerkschaften dort weiterhin einen stärkeren Einfluss haben.
Allein aus diesen Zahlen ergibt sich, dass der DGB natürlich nicht der einzige Ort ist, wo Arbeiter:innen angesprochen und organisiert werden können, sondern es ein sehr großes Feld an unorganisierten Arbeiter:innen gibt, bei denen nicht automatisch die Organisierung innerhalb des DGB heute der beste Schritt ist, um sie in eine klassenkämpferische Arbeiter:innenbewegung einzubeziehen. Umgekehrt ist es so, dass z. B. gerade in den Kernindustrien des deutschen Imperialismus der Anteil an in DGB-Gewerkschaften organisierten Arbeiter:innen noch immer extrem hoch ist. Hier grundsätzlich auf eine Mitarbeit auf gewerkschaftlichen Ebenen, welche nah an der Basis sind – wie etwa Vertrauenskörperstrukturen – zu verzichten, wäre dementsprechend ebenso falsch.
Also ja: Kommunist:innen sollten in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten. Doch wie und mit welcher Perspektive? Mit der Perspektive, in der revolutionären Situation gewerkschaftliche Organisationen zu haben, die nicht nur als Massenorganisationen für die Arbeiter:innenklasse zur Verteidigung gegen die Angriffe des Kapitals, sondern auch als „Hebel zur Abschaffung des Lohnsystems“ im revolutionären Prozess dienen und nach der Revolution als „Apparat zur Verwirklichung der proletarischen Diktatur“, als „Schule des Kommunismus“.
Da die DGB-Gewerkschaften diese gewerkschaftlichen Organisationen nicht sein werden, darf die gewerkschaftliche Arbeit der Kommunist:innen also grundsätzlich nicht nur auf den DGB begrenzt bleiben oder sich strategisch hauptsächlich darauf konzentrieren. Er darf eben nicht „alternativlos“ sein. Doch wie könnte unsere Alternative aussehen?
Unsere Alternative
Aus den obigen Analysen gilt es Schlussfolgerungen für die eigene revolutionäre Strategie und Taktik im betrieblichen Kampf zu ziehen.
Aus der strategischen Nicht-Eroberbarkeit des DGB ergibt sich grundsätzlich die strategische Notwendigkeit, letztendlich eigene gewerkschaftliche Strukturen im Marx’schen Sinne aufzubauen, Strukturen die heute den ökonomischen Kampf mitprägen können und zugleich als Keimformen von Massenorganisationen der Arbeiter:innenklasse in der Revolution,wie im sozialistischen Aufbau dienen können. Dies wurde oben bereits ausführlich dargelegt.
Was bedeutet das für uns jedoch heute taktisch?
1. Klassenkämpferische Strukturen für den betrieblichen Kampf schaffen – innerhalb und außerhalb der gelben Gewerkschaften
Es bedeutet schon heute in jeglicher betrieblichen Arbeit immer auch eigene Strukturen als Keim solcher gewerkschaftlichen Strukturen mitzudenken und zu schaffen. Das heißt es gilt, Kerne klassenkämpferischer Kolleg:innen in Betriebsgruppen zusammenzufassen, welche Interesse an einer konsequenten gewerkschaftlichen und klassenkämpferischen Politik haben. Als solche Betriebsgruppen haben wir die Aufgabe, eine eigenständige Politik im Betrieb zu entwickeln:
- Dauerhafte systematische Kontaktarbeit und Diskussionen mit Kolleg:innen, um das eigene Netzwerk im Betrieb stetig zu erweitern.
- Alle Mittel der politischen Medienarbeit nutzen um das Klassenbewusstsein im Betrieb zu heben und die politische Stimmung im Betrieb zu beeinflussen.
- Regelmäßig die betriebliche Lage zu analysieren und entsprechend zu reagieren.
- Konflikte aufnehmen und entsprechend der Kräfteverhältnisse Aktivitäten dazu entwickeln – von kleinsten Aktionen bis hin zur Organisierung von legalen oder wilden Streikaktionen.
- Vernetzungs- und Organisierungsarbeit mit anderen klassenkämpferischen Kräften.
Das heißt, dass wir heute also nicht einfach neue Gewerkschaften gründen können oder sollten, jedoch eigenständige Strukturen schon heute in Keimform angelegt werden müssen, um perspektivisch unserem strategischen Ziel näher zu kommen.
Eine Aufgabe von solchen Betriebsgruppen ist dementsprechend auch, dort wo die Einzelgewerkschaften des DGB oder anderer gelben Gewerkschaften in den Betrieben, in denen wir arbeiten, noch stark sind, eine gezielte Arbeit innerhalb dieser Strukturen durchzuführen. Politisch gilt es dabei, eine klassenkämpferische Linie voranzutreiben und gegen die Sozialpartnerschaft einzutreten. Organisatorisch sollten wir uns stets darum bemühen, alle Möglichkeiten zu nutzen, Räume für die Selbstaktivität der Kolleg:innen zu schaffen und zu erweitern und diejenigen innergewerkschaftlichen Strukturen und Mechanismen zu nutzen, die es gibt (z. B. gemeinsam gegen einen schlechten Tarifabschluss zu stimmen etc.). Diese Arbeit darf jedoch niemals dazu führen, dass wir in ihr voll und ganz aufgehen und somit zum Anhängsel der gelben Gewerkschaft und letztlich ihrem linken Feigenblatt werden.
Dort wo gelbe Gewerkschaften schwach oder gar nicht vorhanden sind, müssen wir derweil genau untersuchen, inwiefern es schon heute möglich ist, hier alleine auf die eigenen Kräfte gestützt eine gewerkschaftsähnliche Arbeit zu entwickeln.
2. Kader:innen aus der betrieblichen Arbeit gewinnen
Eine betriebliche Strategie und Taktik darf jedoch nicht nur aus dem engen Gesichtsfeld des betrieblichen Kampfs gedacht werden. Beides muss letztendlich der Gesamtaufgabe untergeordnet sein, vor der die Kommunist:innen als fortgeschrittenster Teil unserer Klasse heute stehen: Der Schaffung einer in der Klasse verankerten Kommunistischen Partei und mit ihr verbundener Massenorganisationen als Transmissionsriemen in die Klasse.
In diesem Sinne muss die betriebliche Arbeit auch diesem Ziel zuarbeiten. Dafür sind oben genannte eigenständige Betriebsgruppen diejenigen Strukturen, welche am besten den Zweck erfüllen, Arbeiter:innen aus den Betrieben für eine klassenkämpferische Linie und Politik zu gewinnen, und von betrieblichen Aktiven hin zu kommunistischen Kader:innen zu entwickeln. Wer sich dabei ausschließlich auf die Strukturen des DGB begrenzt, wird scheitern.
Damit die Gewinnung von Kräften aus der direkten Betriebsarbeit gelingt, müssen solche eigenen betrieblichen Strukturen jedoch auch mit anderen klassenkämpferischen Kräften und politischen Kämpfen außerhalb des Betriebs verbunden sein. Auch wenn ökonomische und politische Angriffe innerhalb des Betriebs stärker werden, ist die Politisierung über kulturelle Aktivitäten, kommunistische Bildung und Kämpfe auf der Straße außerhalb der engen betrieblichen Sphäre notwendig, um Arbeiter:innen allseitig politisch zu entwickeln. Aus diesem Grunde müssen klassenkämpferische Massenorganisationen im betrieblichen Bereich auch zu Themen außerhalb des Betriebs arbeiten und selbst Platz für Einflüsse aus anderen politischen Kämpfen schaffen. Dabei können solche betrieblichen Massenorganisationen umgekehrt auch die Rolle einnehmen, selbst die Bedeutung des Betriebs als Kampffeld in andere Kämpfe hineinzutragen, wo diese oftmals unterschätzt werden oder untergehen.
**
Die betriebliche Taktik für die aktuelle Periode kann deshalb wie folgt zusammengefasst werden: Aufbau eigener klassenkämpferischer gewerkschaftsähnlicher Strukturen in den Betrieben, die je nach Bedingungen auch die Strukturen der betrieblichen „Mitbestimmung“ und der gelben Gewerkschaften für die Umsetzung der eigenen Politik nutzen können; Einbettung dieser Strukturen in betriebsübergreifende allgemeinpolitische Organisationen, die Teil einer umfassenderen klassenkämpferischen Arbeiter:innenbewegung werden; Gewinnung kommunistischer Kader:innen aus dieser Arbeit, um eine zu schaffende Partei eng mit dem Betrieb als Kampffeld zu verzahnen.
Mit der Mystifizierung des DGB brechen
Viele Kommunist:innen in Deutschland teilen grundsätzlich eine kritische Analyse des DGB. Sie prangern dessen Sozialpartnerschaft an und begrüßen auch wilde Streiks und spontane Arbeitskämpfe, wenn diese stattfinden. Zugleich reagieren sie außerordentlich allergisch, wenn diese Analyse konsequent zu Ende gedacht wird und entsprechende Schlussfolgerungen für die eigene Praxis gezogen werden müssten. Wenn die Strategie der Eroberung des DGB-Apparats in Frage gestellt wird, oder die Notwendigkeit eigener gewerkschaftlicher Strukturen herausgestellt wird, kann es schnell giftig werden. Hier zeigt sich eine weit verbreitete Mystifizierung des DGB, in den etwas hineininterpretiert wird, was niemals der Fall sein kann. Man bleibt am Mythos der „Einheitsgewerkschaft“ kleben, auch wenn sich in der Praxis täglich zeigt, dass diese sich letztlich der Bourgeoisie unterordnet und die Arbeiter:innenklasse politisch und organisatorisch entwaffnet. Das Ergebnis ist eine umfassende Nachtrabpolitik, weil per Definition quasi keine wirklich konsequente Opposition stattfinden soll.
Dadurch entsteht die eigentlich absurde Situation, dass es gerade die linken und teilweise sogar revolutionären Kräfte sind, welche die gelben Gewerkschaften mit ihrer Einsatzbereitschaft und Elan am leben halten und „attraktiver“ machen. Auf unterer Ebene werden immer wieder ganze Strukturen des DGB oder seiner Jugendorganisationen von Genoss:innen getragen, die sich selber als Marxist:innen verstehen – ohne dass sich jedoch die grundlegende Politik des DGB geändert hätte. Im Gegenteil verbleiben leider viele dieser Genoss:innen über viele Jahre auf solchen Posten, werden systematisch integriert, machen ihre politische Aktivität von Geldern des DGB abhängig und werden somit selbst Teil des Apparats.
Wie ist das zu erklären? Hier verschränken sich mehrere Ursachen miteinander. Zum einen sozialdemokratische Traditionen, welche die kommunistische Bewegung seit Jahrhunderten prägen: Von der viel zu späten Abspaltung der KPD von der SPD im Jahr 1919 über die nicht zu Ende geführte Bolschewisierung in den 1920er Jahren, die Rechtsentwicklung der KPD ab den 1940er Jahren oder die Auflösung großer Teile der K-Gruppen in die Sozialdemokratie.
Zum anderen ein politischer Defätismus, bei dem die Genoss:innen im Anblick der Schwäche der eigenen Kräfte nicht daran glauben, man könnte selber in die Lage kommen, etwas aufzubauen und sich aus diesem Grunde an etwas Größeres anlehnen. Damit einher geht eine bestimmte politische Bequemlichkeit, den Konsequenzen einer revolutionären Politik aus dem Weg zu gehen.
Dies wird jedoch auch dadurch verstärkt, dass es noch zu sehr an aktuellen praktischen Beispielen mangelt, in denen aufgezeigt wird, dass eine andere Gewerkschaftspolitik möglich ist. Dass es möglich ist, Massenpolitik zu machen, ohne nach rechts zu gehen. Die reine theoretische Kritik wird deshalb auch nicht ausreichen, um große Teile der revolutionären und kommunistischen Bewegung von ihrer Richtigkeit zu überzeugen. Wir müssen den Beweis selbst durch die erfolgreiche Entwicklung einer entsprechenden Praxis liefern. Dafür gilt es, auf unsere eigene Kraft als kommunistische Bewegung zu vertrauen, praktisch die heute vorherrschenden falschen Tendenzen von einer revolutionären Strategie ausgehend zu überwinden und Fortschritte beim Wiederaufbau einer klassenkämpferischen Arbeiter:innenbewegung zu erkämpfen.
1 Marx, Karl (1865): Lohn, Preis, Profit. MEW 16. S. 152
2Arbeitgeber fordern: Deutsche müssen einfach länger arbeiten, https://www.schwaebische.de/wirtschaft/arbeitgeber-fordern-deutsche-muessen-einfach-laenger-arbeiten-3306927
3Vgl. dazu den Artikel zum deutschen Imperialismus in dieser Ausgabe.
4Nazarenko, Phillipp (2024): Wie uns die Sozialpartnerschaft aus IG Metall, SPD und Waffenlobby in den Krieg führt. In: https://perspektive-online.net/2024/02/wie-uns-die-sozialpartnerschaft-aus-ig-metall-spd-und-waffenlobby-in-den-krieg-fuehrt/
5Berufsverbot wegen Protest gegen den Völkermord in Gaza: https://offene-akademie.org/berufsverbot-wegen-protest-gegen-den-voelkermord-in-gaza/
6Wheeler, George S. (1958): Die amerikanische Politik in Deutschland (1945-1950). S. 39 f.
7Der Aufsichtsratsvorsitz mit doppelter Stimme wird dabei von der Kapitalseite gestellt, sodass die tatsächliche Macht immer in den Händen der Unternehmer:innen verbleibt.
8Bois, Marcel / Jaeger, Alexandra (2023): Die Grenzen der Toleranz – 50 Jahre Unvereinbarkeitsbeschlüsse des DGB. In: https://www.fes.de/feshistory/unvereinbarkeit
9Will, Klaus / Schaad, Ilse (2023): So wie es ist, so wird es nicht bleiben. In: https://www.gew-berlin.de/aktuelles/detailseite/so-wie-es-ist-so-wird-es-nicht-bleiben
10Jaeger, Alexandra (2022): „Wendepunkt zum Unrechtsstaat?“ Gewerkschaftliche Kritik am Radikalenbeschluss von 1972. In: https://www.fes.de/feshistory/blog/radikalenbeschluss
11So wurde 1973 etwa von der RGO dazu aufgerufen, den 1. Mai „unter der Fahne der KPD“ zu begehen. (Vgl. https://web.archive.org/web/20221205001816/https://www.mao-projekt.de/BRD/DGB/AO/KPD-RGO_Erster_Kongress.shtml)
12Vollmer, Peter (2003): Autobiographie, 1976 bis 1978 Zwei Jahre im Kabelwerk Winkler in Berlin – Ein Rückblick nach persönlichen Aufzeichnungen, trafo Verlag, S. 17
13DGB (2025): Gewerkschaft in Zahlen. In: https://www.dgb.de/der-dgb/geschichte-des-dgb/#c9202
14Verdi News – Informationen für Aktive, Nr.3, 15. Februar 2025
15Dribbusch, Heiner / Birke, Peter (2012): Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland – Organisation, Rahmenbedingungen, Herausforderungen. In: https://library.fes.de/pdf-files/id-moe/08986.pdf
16Alle Aktien (2025): Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften AG (BGAG). In: https://www.alleaktien.de/lexikon/beteiligungsgesellschaft-der-gewerkschaften-ag-bgag
17Nathusius, Ingo (2022): Metaller-Tarifrunde: Die Streikkasse ist gut gefüllt. In: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/igmetall-tarifrunde-101.html
18Tschernig, Fridolin (2023): Deutsche Post: Ver.di und der „Klassenkompromiss“ In: https://perspektive-online.net/2023/04/post-ver-di-und-der-klassenkompromiss/
19Lenin, Wladimir I. (1920): Der linke Radikalismus – die Kinderkrankheit im Kommunismus, LW 31, S. 31 ff. Alle folgenden Zitate in dem Kapitel beziehen sich auf diesen Text, wenn nicht anders gekennzeichnet.
20ADGB, SPD, USPD, KPD (1920): Gemeinsamer Aufruf des ADGB, der SPD, der USPD und der KPD vom 7. August 1920 zur Verhinderung des Transports von Truppen und Kriegsmaterial durch Deutschland nach Polen. In: Dokumente zur deutschen Geschichte 1919-1923. Berlin 1975. S. 46f
21vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (1858): Engels’ Brief von 1858 an Marx über die englischen Arbeiter, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, S. 131/132